MENÜ
Astorga, ab hier wird es bergig, nach den endlosen, flachen Geraden der Meseta. Bis Santiago de Compostela wird es ein auf und ab, auf dem Camino Frances 2023.
Nach dem Ruhetag und der Gaudi-Palast Besichtigung fühle ich mich gut und starte früh. Es ist mir nicht klar, welche Herbergen am Weg offen haben werden, so spiele ich bereits am Anfang mit dem Gedanken, dass Bergmassiv an einem Tag zu überqueren.

Bevor ich nach Rabanal komme, kehre ich diesmal noch in Santa Catarina ein. Ein Kaffee mit Croissant muss sein, denn wenn ich Pech habe, ist es die letzte Gelegenheit, bis ins weit entfernte Molinaseca. Eventuell gibt es noch etwas in Rabanal, aber darauf möchte ich mich nicht verlassen.
Unerwartet kommt der Franzose Pierre in den Gastraum. Er hat mich an meinem Ruhetag überholt und hier genächtigt. Er ist Trailrunner und bereitet sich auf einen Lauf vor. Jeden dritten Tag macht er etwa 50 Kilometer, wovon er die Hälfte läuft und dann zwei Tage lang etwa 25 km, in denen er nur geht. So gewöhnt er seinen Körper an die Belastung. Wir haben uns das erste Mal in Carrion getroffen, wo wir zu dritt im Kloster genächtigt haben. Er hat nur einen kleinen Laufrucksack mit 15 Liter Volumen dabei und daher nur das Notwendigste. Sehr bescheiden für den Winter, aber eben nur das, was er wirklich braucht.
Ich beneide ihn um das geringe Gewicht, denn ich habe mindestens das Doppelte mit. Ich starte vor Ihm, im Glauben, von ihm bald eingeholt zu werden. Doch wiedersehen werde ich ihn erst in Villafranka wieder, zwei Tage später. In Rabanal, 10 Kilometer weiter, hat mein Lieblings-Café erstmals geschlossen. Enttäuscht gehe ich weiter und jausne etwas außerhalb der Ortschaft. Allerdings soll in Foncebadon etwas offen haben, der letzten Ortschaft vor dem Crux de Ferro. Auf meinem Wintercamino 2020 hatte dort damals alles zu.
Es überrascht mich, dass auf dem Weg nach oben nur wenig Schnee liegt und das meist nur in Schattenlagen oder auf der nördlichen Seite. Trotzdem ist es heftig, denn Schnee ist nicht mein Terrain. Da merke ich besonders, wie sehr mir das Gefühl und die fehlende Propriozeption in den Beinen fehlt. Ich trete im Schnee zu hart auf, weil ein anderer Krafteinsatz gebraucht wird, den ich nur selten üben kann. Die Bewegung gleicht einem Betrunkenen, da ich immer wieder wegrutsche und die Kraft nicht richtig dosieren kann.
Aber ehe ich mich versehe, bin ich in Foncebadon. Und wirklich, die Herberge hat offen, aber auch doch nicht. Ich überlege kurz, hierzubleiben, um am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang am Crux de Ferro stehen zu können.
Allerdings verwerfe ich den Gedanken gleich wieder, weil eine Pilgerin vor der Herberge wartet und mir sagt, dass die Wirtin erst wieder in zwei Stunden zurück kommt. Solange möchte ich nicht im Freien warten und entschließe mich für den langen Weg nach Ponferrada und gehe weiter.
Um 13 Uhr bin ich am Kreuz angelangt. Alleine, denn Pierre hat mich noch nicht eingeholt. Ich lasse mir Zeit, denn das Ritual ist mir wichtig, hier einen Stein abzulegen, als Metapher für eine Last, die man ab jetzt hinter sich lässt. Nur der Wind pfeift, ansonsten stört mich kein Geräusch. Ich mache ein paar Fotos, lege mich ins Gras und esse wieder.
Im Sommer spielt es sich hier ab, aber jetzt im Winter, bin ich alleine und genieße es. Obwohl noch über 20 Kilometer vor mir liegen, habe ich keine Eile. Es zählt der Moment und der sagt mir, lass dir Zeit.
Nach einer halben Stunde mache ich mich auf den Weg. Der Herausfordernste Teil steht mir bevor. Die extrem vielen Steine machen den Weg besonders schwer. Viele haben hier zu kämpfen, mir aber gefällt das Terrain, denn hier lernte ich viel in den vergangenen Jahren. Seitdem kippe ich kaum noch um.
Diese Kräftigung im Sprunggelenk hatte ich zu lernen, um nicht dauernd umzukippen, was bei mir ein großes Problem darstellte. Allerdings wurde mit der Stärkung das Roboterhafte Gehen stärker, was ich erst später, mit dem therapeutischen Tanzen, in den Griff bekam.
Geschmeidigkeit und Stärke verbinden, seither sieht es normal aus, wie ich gehe und deshalb sieht man mir fast nichts an. Die Tanztherapie verhilft mir, meine Muskeln, Sehnen und Gelenke elastischer und schonender zu verwenden. Es dauerte lange, bis es so weit war, aber es war der Grundstock dafür, um lange Wanderungen machen zu können. Das hilft mir im Alltag sehr, denn ich kann mich seitdem mehr um den Verkehr in der Stadt oder was ich einkaufe, kümmern.
Früher war die Aufmerksamkeit bei meiner Bewegung und darauf zu achten, nicht umzukippen. Ein riesiger Lebensgewinn.
Abwechselnd zwischen Schnee, Nordhängen und den vielen Steinen, "tänzle" ich nach unten. Kurz nach Mandarin überhole ich eine Pilgerin, die übervorsichtig und langsam dahinschreitet. Ich frage sie, ob es ihr gut geht und ob sie was braucht. Sie sieht abgekämpft und müde aus, was um diese Zeit und in dieser Gegend ein schlechtes Omen ist. Sie verneint aber, was ich ihr aber nicht so recht glaube. In diesem Tempo braucht sie noch lange bis ins nächste Dorf.
Da es mittlerweile schon 14 Uhr ist, wird sie bis zum Anbruch der Dunkelheit unterwegs sein. In diesem nächsten Dorf, in El Acebo, gibt es nur ein teures Hotel, dass offen haben soll. Gut für Wanderer, die es nicht so weit schaffen, aber nichts für meinen doch recht schmalen Geldbeutel. Ich habe zwischen 20 und 30 Euro am Tag, für Nächtigung und Essen, Hotelzimmer sind da nicht drin. Ich gebe der Pilgerin den Rat, auf die Straße zu wechseln, da sie über den Pfad zu langsam vorwärts kommt.
Mein Körper fühlt sich hingegen immer leichter an und die Bewegung auch. Bergab überkommt es mich und ich versuche immer wieder, 20 - 30 Meter zu laufen. Es ist ein so tolles Gefühl, denn die Erschütterung beim Auftreten bewirkt eine elektrische Ladung meines gesamten Körpers. Wie sehr habe ich das vermisst!
Dann noch die letzte Steilstufe und ich stehe in Molinaseca. Da es schon spät ist, verzichte ich darauf einzukehren und gehe weiter nach Ponferrada, in die öffentliche Herberge. Der Hospidalero serviert mir eine selbstgemachte Suppe, mit allem drinnen, was man sich vorstellen kann. Nach 11 Stunden am Weg, eine Köstlichkeit, wie ich sie mir nicht besser vorstellen kann.
Am Abend liege ich im Bett und plane die weitere Strecke. Ich muss mich entscheiden, ob ich am Camino Invernio gehe oder am Camino Frances bleibe. Aufgrund der ungewissen Herbergssituation entscheide ich mich für den Französischen Weg. Im gesamten Jänner waren nur rund 30 Pilger auf diesem Weg unterwegs und auch jetzt sind nur wenige Pilger unterwegs. Die Frage, wieviele Herbergen sind geheizt, möchte ich mir nicht stellen, da ist der französische Weg sicherer. Also weiter, dem Camino France folgen.
In der Herberge lerne ich Frederic aus Tschechien kennen, der mit noch weniger Geld unterwegs ist, als ich. Er ist Yoga-Lehrer und spielt eine Menge Musikinstrumente. Die Unterhaltung tut mir gut mit ihm.
In Ponferrada lasse ich mir Zeit und gehe erst spät los. Nach Villafranka sind es nur 23 Kilometer. Auf dem Weg überhole ich Frederic und wir unterhalten uns, im speziellen über Musik. In einem Cafe lade ich ihn zu einem Kaffee ein und er lernt mir einen Rhythmus, der zwar einfach ist, aber doch wieder nicht für mich. Ich merke, wie sich mein Gehirn anstrengen muss, diesen Rhythmus länger aufrecht zu halten. Eine gute Übung für mein Gehirn und die folgenden Etappen übe ich immer wieder mit meinen Stöcken, am Boden aufschlagend, den Rhythmus.
In der Herberge in Villafranka treffe ich wieder auf Pierre. Ich schlage ihm vor, in C´Obreiro weiterzugehen und in der nächsten Herberge zu Nächtigen. Bis dorthin geht fast keiner weiter und die Herberge dort ist toll. Es ist eine Öffentliche, aber auf dem neuesten Stand. Allerdings gibt es keine offene Bar oder etwas zum Essen, man muss alles selber mitbringen. Wir sind dort dann die einzigen Gäste und haben das Haus für uns. Kein Geschnarche anderer stört uns und wir können seit langem ungestört schlafen. Die paar Kilometer Mehrweg haben sich ausgezahlt.
Am Morgen gehen wir zusammen bis Triacastele, wo wir hervorragend Frühstücken. Hier trennen sich unsere Wege, denn ich gehe nach Samos und möchte im dortigen Kloster nächtigen. Es ist ein Umweg von 15 Kilometer, der es aber wert ist.
Traumhafte verschlungenen Pfade und eine einmalige Natur empfangen mich. Moosbewachsene Bäume und Steine, in allen Grüntönen, lassen mich wie im Paradies sein. Als ich in Samos ankomme, wähne ich mich im Ziel, aber es sollte anders kommen. Der Mann, der die Herberge betreut hat, dürfte gestorben sein, wenn ich es vom Tankwart der Tankstelle neben der Herberge, richtig mitbekommen habe. Die Mönche haben die Leitung übernommen, kommen aber erst am Abend wieder.
Solange möchte ich aber nicht warten und obwohl es schon spät ist, werde ich weitergehen. Um halb vier starte ich in Samos und gehe im Schnellschritt ins 15 Kilometer entfernte Sarria, dass ich eigentlich vermeiden wollte. Ich bin schon nach zweieinhalb Stunden dort und gerate in den Karnevallsumzug. Nach den Tagen in den Bergen ein Kulturschock, mit so viel Pauken und Trompeten empfangen zu werden. Der Fasching ist in vollem Gange und ich habe ihn voll vergessen.
Ich habe mir ein Zimmer genommen und schreibe Pierre, dass ich jetzt doch nach Sarria gekommen bin. Ein paar Minuten später schreibt er zurück und wir kommen drauf, dass wir einander angrenzende Zimmer im gleichen Hotel haben. Wir verabreden uns zum Abendessen, wo wir eine angenehme Unterhaltung führen. Mit einer Person geht es ganz gut, aber mehrere am gleichen Tisch überfordern mich noch.
Die kurze Etappe nach Portomarin ist schwerer als gedacht. "Nur" 25 km, aber die haben es in sich. Allerdings eher mental, als körperlich. Wobei das eine, es mit dem anderen hat. Es ist eine mentale Sache, denn ich bin kaum motiviert und schlendere dahin. Pierre bricht erst viel später auf und berichtet mir in Portomarin, daß es ihm gleich ging. Schwere Beine und kaum offene Cafés, machen es "schwer".
Ich kehre nur in ein einziges offenes Café unterwegs ein und schaue sonst nur, daß ich den Zielort erreiche. Testhalber versuche ich mich zu motivieren und siehe da, es funktioniert. Kaum bekomme ich Spannung in den Körper, sind die Beine ok und das Gehen passt. Ich mag aber nicht und lasse mir Zeit.
Trotzdem überholen ich viele Tagespilger. Es sind Spanier, die das Wochenende nutzen oder in den folgenden Tagen auch nach Santiago gehen. Man erkennt sie an den meist sehr kleinen Tagesrucksäcken, denn der große wird vom Gepäckdienst transportiert. Es sind im Verhältnis bisher sehr viele unterwegs, allerdings sind die öffentlichen Herbergen zum Glück den Pilgern vorbehalten, die ihr Gepäck selbst tragen. So bleibt immer genug Platz.
Mein langer Tag bringt mich bis nach Arzua. Ein Regnerischer Morgen zieht sich durch den Tag. Richtig schön wird es nie und es bleibt kühl. Das motiviert aber zum Gehen und in Bewegung bleiben. Wenn ich daran denke, daß ich vor Jahren noch solche Probleme in der Kälte hatte. Das viele Training und das oftmalige Kneipen im Winter, hat mich daran gewöhnt und es hat sich ausgezahlt, über die vielen Jahre, die Mühen auf sich zu nehmen.
Auf diesem Camino ist es erstmals, eben seit sieben Jahren, dass ich über viele Dinge, unter anderem die Kälte, kaum mehr nachdenken muss. Allein dieser Gedanke lässt mich frei und unbekümmert dahin schreiten.
Eine kurze Etappe bringt mich nach O Pedrouzo. Hier treffe ich mich wieder mit Pierre, der heute seinen langen Tag macht. Seine 50 Kilometer hat er in etwa 6 Stunden zurückgelegt. Da kann er ruhig später aufstehen. Wir unterhalten uns viel über Ausrüstung und deren Optimierung. Das macht mir Spaß, denn in den letzten Jahren konnte ich mich kaum mit jemanden darüber unterhalten oder austauschen und musste alles selbst ausprobieren.
Da Pierre heute seine Wäsche wäscht, leihe ich ihm meine Regenhose zum Einkaufen gehen. Er ist so minimalistisch unterwegs, dass er keine Ersatzkleidung dabei hat.
In der Früh lassen wir uns Zeit und gehen spät los. Es ist Anfangs regnerisch, aber das macht uns mittlerweile nichts mehr. Wir tratschen viel auf dem Weg nach Santiago und erreichen zu Mittag die Kathedrale. Nach 26 Tagen habe ich Santiago de Compostela erreicht und 845 km liegen hinter mir. Regen, Schnee und Sonne waren mein Begleiter und tatsächlich habe ich nur einige Regentage darunter, vor allem am Schluss.
Allerdings habe ich kaum Gefühle oder Emotionen in Santiago. Ich freue mich zwar, aber nicht mehr. Zu sehr fordert mich die große Stadt und Emotionen haben keinen Platz. Am Abend gehen Pierre und ich noch essen und verabschieden uns dann. Es waren feine Tage mit ihm.
Als Resümee vom Weg kann ich bisher ziehen, dass ich alles anders erleben durfte, als bisher. Es stand nicht die Therapie im Vordergrund, sondern erstmals das Leben. Ich hatte mir zwar Aufgaben vorgenommen, sowie die Achtsamkeit beim Gehen, denn die Automatik fehlt eben noch, aber nicht mehr. Jedoch war es eine tolle Erfahrung, dass ich nicht mehr in allem was ich tue, Therapie darin sehe. Das ist ein wichtiges Stück näher zum Leben, dass ich hier erreicht habe und zuhause auch umsetzen möchte.
Einen großen Anteil daran hatte meine Tanz-Therapeutin Hanna Treu, wo ich speziell im letzten Jahr wieder intensiv übte und trainierte und der mein besonderer Dank für die Arbeit mit mir gilt. Ohne Das therapeutische Tanzen wäre viel nicht möglich geworden.
Santiago ist für mich aber nur ein Zwischenziel, denn noch wartet der Camino Finesterre, wobei ich allerdings dieses Mal erst Muxia ansteuern und dann nach Finesterre komme werde. 200 Kilometer, die ich zum Ausklingen nutze werde.
Dazu mehr das nächste Mal.
Seit einem Monat bin ich am Camino France unterwegs und dabei begleitet mich immer wieder ein Krafttier, dass mir etwas sagen möchte. In diesem Fall möchte ich näher auf das Krafttier Hausrotschwanz eingehen.
Immer wieder entstehen mit Tieren Situationen, die oft unwirklich scheinen und Emotionen und Gefühle in mir wecken. Die Begegnung mit dem Krafttier Hausrotschwanz war so eine.


Schon in der Früh war ich unruhig und ich bemerkte, mein Geist ist mit etwas beschäftigt. Der Weg war schön, von Oliveiroa weg, nach Muxia, ans Meer führend. Es war die erste Stadt am Meer, vor Finesterre. Diesmal wollte ich den Weg umgekehrt gehen, wie im Jahr zuvor, zuerst nach Muxia und dann erst nach Finisterre.
Im ersten aufkeimenden Tageslicht kamen mir so manche Gedanken, allerdings einer hielt sich besonders fest. War ich noch am richtigen Weg?

Diese Frage stellte sich mir? Es war nicht der richtige Weg nach Muxia gemeint, sondern mein Weg durchs Leben. Denn nur Gehen konnte nicht alles sein. Mein "Überleben" des Hirnabszess hat einen tieferen Sinn, den ich mittlerweile zwar logisch verstehe, den ich aber noch nicht leben oder umsetzen kann.
Eigentlich ist es eine Frage nach dem Sinn des Lebens, die immer öfter aufkommt. Welchem Zweck dient mein Dasein? Es geht hier um tiefgreifende Dinge, denn von einem "normalen" Leben, wie die meisten es kennen, bin ich ausgeschlossen. Arbeit, Familie, Pension - alles ist anders für mich.
Seit bald sieben Jahren besteht mein Leben aus Rehabilitation, darum gehe ich auch hier am Jakobsweg in Spanien, mittlerweile zum sechsten Mal. In der Bewegung bin ich behindert, trotz der vielen Kilometer, die ich bisher zurücklegte.
Bin ich also noch am richtigen Weg?
Die letzten sieben Jahre waren von Rehabilitation geprägt, alles andere war zweitrangig. Ich bin froh darüber, solange durchgehalten zu haben, denn nach diesem Siebener-Zyklus kann ich mir erstmals Gedanken über meinen weiteren Sinn des Lebens machen. Einen wichtigen Hinweis gab mir das Krafttier Hausrotschwanz.
Der Hausrotschwanz ist normalerweise sehr scheu und fliegt davon, wenn wir uns ihm nähern. Ich hatte in den letzten Wochen viele Begegnungen mit dem Rotkehlchen, das mir die Lebensfreude vermittelt, allerdings einen Hausrotschwanz bin ich auf diesem Camino noch nie begegnet.
...und dann saß es plötzlich da! Direkt vor mir und starrte mich an. Nur rund eineinhalb Meter entfernt und flog nicht weg. Ich blieb stehen und schaute es freundlich an. Es war ein tolles Gefühl, uns gegenseitig ins Gesicht zu schauen. Nach einer Minute, die wie eine Ewigkeit schien, ging ich weiter. Der Hausrotschwanz flog mit mir mit und setzte sich alle paar Meter auf einen Ast neben dem Weg und beäugte mich, als wolle er mir etwas sagen. Nach einiger Zeit verschwand er.
Ich sah nach, was es bedeutet und schon die Überschrift überraschte mich. Das folgende ist dem Blog von Kathrin Siedler entnommen. Der Link dazu ist weiter unten:
"Der Hausrotschwanz fliegt in dein Leben und bringt dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit.Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, dann halte inne. Bleib bei dir und halte inne. Berühre den Zweifel und dann gib dem Vertrauen Platz. Der Weg, auf dem du bist, ist jetzt der für dich richtige. Das ist klar. Gehe weiter mit all den Erkenntnissen, die du in letzter Zeit hattest und vertraue. Jetzt bekommst du nämlich Führung. Führung von deiner Intuition. Lasse dich führen und die Antworten auf deine Fragen werden zu dir kommen. Lasse Emotionen zu, lasse sie ziehen und genieße die Klarheit.
Dein dich verführender Hausrotschwanz"
Der Link zur Seite: https://kathrinsieder.at/krafttier-hausrotschwanz
Jede dieser Zeilen passt. Am nächsten Tag traf ich einen Pilger, mit dem ich in der Früh eine Stunde sprechen konnte. Es war genau das Gespräch, dass ich zu diesem Zeitpunkt brauchte. Es brauchte dazu 1.000 Kilometer über Stock und Stein, um mich hierher zu führen.
Jeder Schritt, jede Entscheidung und jede Tat in den letzten 30 Tagen, war notwendig, um genau um diese Uhrzeit und an diesem Tag, an dieser Stelle zu sein und das Gespräch führen zu können.

Die Pilgertour von Bayonne nach Finesterre war toll, aber in den ersten 28 Tagen hatte ich noch nicht die erhofften Erkenntnisse erhalten. Aber das ist der Zauber des Camino. Erst am 29. Tag, fast am Ende, mit der Begegnung mit dem Krafttier Hausrotschwanz, änderte sich alles. "Du bist am richtigen Weg!", zerstreute alle meine Zweifel und Bedenken.
Am 30. Tag war es dann soweit. Es war nur eine Stunde, aber die war Richtungsweisend für mein Leben. Während des Weges fragte ich mich öfter, was hat das jetzt wieder für einen Sinn? Ich vertraute darauf, dass das Richtige schon kommen wird. Mal kommt es früher, mal später, aber es kommt. Viele geben zu früh auf, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Sie bekommen nämlich das, was sie brauchen und geben dann auf, weil es nicht das erhoffte ist.
So hält der Camino zahlreiche Weisheiten bereit für den, der bereit ist hinzuhören und hinzuschauen. Das macht den Weg so besonders und macht ihn so magisch.
Jetzt weiß ich einen weiteren wichtigen Punkt, um den Sinn, den mein Leben ausmacht. Ich bin froh mir gegenüber, im Vertrauen geblieben zu sein. Die nächsten Tage werde ich ruhig angehen, um darüber nachzudenken und es im Herz aufnehmen zu können.
Herzlichen Dank, lieber Hausrotschwanz!
Als Erstes steht die Meseta an, bevor es dann über die Berge nach Santiago de Compostela geht. Die Meseta beginnt in Burgos und reicht bis nach Astorga, 226 km weit. Die endlosen Geraden bieten sich zum Gehen an.
Das Schreiben stelle ich in den Hintergrund, zu groß ist die Freude am Gehen und das (Er)leben im Hier und Jetzt. Ich habe die letzten Jahre viel dafür getan und darf nun die Früchte ernten, denn ich kann alles besser wahrnehmen und es wird dadurch leichter.

Ich starte im Dunkeln, lasse mir aber Zeit. Die Morgenstimmung in der Meseta ist immer etwas Besonderes. Beladen mit frischem Brot, einer Avocado und genug zum Trinken, mache ich mich auf den Weg. Die ersten Kilometer noch total flach, zieht es sich dann leicht an- und absteigend dahin.
Hontanas ist mein Ziel und der Himmel wolkenlos. Beim Weg aus der Stadt erreicht mich die Sonne. Nach zehn Kilometern gibt es den ersten Kaffee unterwegs, der an diesem Tag auch mein einziger bleiben wird.
Einen Fuß vor den anderen, so schreite ich dahin. Die ersten zwei Tage auf der Meseta sind nicht total flach, sondern ziehen sich leicht über die Hügel. Meine Bewegung spielt nur am Rande eine Rolle. Dieses Gefühl habe ich erstmals und kann daher viel mehr sehen.
Am nächsten Tag geht es im Dunkeln los, die bis Castrojertz anhält. Ich erlebe ein tolles Ende der Nacht und einen schönen Sonnenaufgang. Bei einigen der eindrucksvollsten Gegenden der Meseta komme ich bei schönstem Wetter vorbei.
Allerdings ist es noch recht kalt, wird sich aber bis Mittag auf mehrere Plus-Grade erhöhen. Die ersten schönen Meseta Bilder gelingen mir bei schönstem Wetter, es ist wieder Wolkenlos.
Ein langer Tag liegt vor mir. Diesmal will ich ihn ganz bewusst gehen – Schritt für Schritt. Viele Pilger überspringen diese langen, flachen Geraden mit dem Bus. Dabei entgeht ihnen etwas Wertvolles. Für mich ist es einer der schönsten Abschnitte des Camino Francés. Gerade weil er sich scheinbar endlos zieht, schenkt er Raum – für Gedanken, für Stille, für das Jetzt. Und diesen Raum möchte ich zu Fuß durchschreiten.
Ich starte früh, gegen sieben Uhr morgens. Mein Ziel ist Carrion de los Condes – irgendwann am späten Nachmittag, vielleicht gegen 18 Uhr. Viel Zeit also, um mit mir selbst ins Gespräch zu kommen. Denn Gehen, wenn man es zulässt, klärt den Geist. Es ist wie ein inneres Ausatmen. Jeder Schritt wird zur Einladung, Altes loszulassen und das Wesentliche zu erkennen.
Fromista erreiche ich nach 34 km, entschließe mich aber zum Weitergehen, hier bleibe ich nicht. Es fühlt sich alles so leicht wie noch nie an. Der Rucksack, das Gehen, alles geht leicht von der Hand. Meine Behinderungen sind noch da, aber alles fühlt sich irgendwie unwirklich an. Seit dem therapeutischen Tanzen im September im letzten Jahr veränderte sich die Wahrnehmung in eine positive Richtung. Natürlich gibt es auch kleine Rückschläge, aber immer zeigt die Tendenz über einen längeren Zeitraum nach Richtung oben. Manchmal kommen mir die Tränen vor Freude, so viel erreicht zu haben.
Die Halbseitenlähmung begleitet mich weiterhin. Besonders den rechten Fuß muss ich im Blick behalten – ihn nicht zu schonen, ihn bewusst zu belasten, das ist entscheidend. Vermeidung schleicht sich schnell ein, wenn man nicht wachsam bleibt. Also trete ich achtsam auf, setze jeden Fuß mit Bedacht, achte auf den Abdruck, die Balance. Es ist Arbeit, aber es ist meine Arbeit – und sie trägt.
Ich bin dankbar, das Schreiben eine Weile ruhen gelassen zu haben. Der Fokus lag ganz auf dem Leben selbst. Und im Hier und Jetzt lebt es sich am klarsten.
Carrion de los Condes erreiche ich spät – gegen 19 Uhr, als die Sonne gerade hinter dem Horizont versinkt. Die Schwester im Kloster, beim Einchecken, kann es kaum glauben: 52 Kilometer an einem Tag? Vielleicht wird auch in Santiago, beim Ausstellen der Compostela, jemand nachfragen, ob ich wirklich zu Fuß gegangen bin – oder doch den Bus genommen habe. Aber ich weiß es. Jeder einzelne Schritt war meiner.

Hinter Carrión de los Condes beginnt ein Abschnitt, der unter Pilgern beinahe legendär ist – berüchtigt, um genau zu sein. 18 Kilometer lang nichts als eine schnurgerade Linie. Kein Dorf, kein Brunnen, kein Schatten. Im Sommer brennt hier die Sonne gnadenlos – 40 Grad sind keine Seltenheit, drei bis fünf Liter Wasser Pflicht. Doch im Winter verliert dieser Abschnitt etwas von seinem Schrecken. Heute früh hat es beim Aufbruch minus drei Grad. Kalt, ja – aber erträglicher als die Hitze, die einen im Sommer fast lähmt.
18 Kilometer Zeit. Zeit zum Nachdenken – oder zum Nichtdenken. Ich entscheide mich für Letzteres. Und plötzlich fliegen die Kilometer nur so dahin. Dieses Nichtdenken ist heilsam. Schon 2018, auf genau diesem Stück, bekam ich zum ersten Mal meine wirre Gedankenwelt in den Griff – einfach, indem ich aufhörte zu denken. Damals war mein Kopf voller Fragen, die sich kreisend ineinander verhakten. Antworten gab es keine, und weiterdenken – das ließ der Hirnabszess nicht zu.
Im vergangenen Jahr passierte es dann in Burgos – eine posttraumatische Belastungsstörung, aus dem Nichts. Ich war nicht vorbereitet. Aber ich ging weiter, Schritt für Schritt über die Weite der Meseta – und das half. Diesmal kam vieles durch das Schreiben an die Oberfläche. Aber ich erkannte es rechtzeitig, ließ es nicht zu groß werden. Im Moment leben, im Hier und Jetzt sein – das ist dann das Beste, was man tun kann.
Denn auch heute noch ist das „Weiterdenken“ eine Hürde. Besonders, wenn es um Vergangenes geht. Dann verfängt sich mein Geist in einer endlosen Schleife aus Fragen. Der Körper reagiert sofort: Blockade, Bewegungsstopp, als würde ein Schalter umgelegt. Nichts geht mehr. Deshalb ist die Arbeit an diesen alten Wunden so entscheidend – und ein großer Teil davon geschieht beim therapeutischen Tanzen. Dort finde ich Wege, wieder zu mir zu kommen. Wege zurück ins Gehen. Wege ins Leben.





Diesmal nutze ich die Kraft der Konzentration, die nur das Gehen schenken kann. Ich fühle mich frei – wie ein Vogel, der lautlos durch die Welt gleitet, schwerelos, losgelöst von dem, was war. Meine Defizite sind da, ja, aber sie beherrschen mich nicht. Zum ersten Mal empfinde ich dieses Gefühl – dieses unglaubliche, dieses große Gefühl von Freiheit. Und es erfüllt mich.
Nach den ersten 18 Kilometern durch die Kälte wirkt das kleine Dorf Calzadilla de la Cueza wie eine Fata Morgana – eine Oase mitten in der winterlichen Meseta. Ein heißer Kaffee, ein windgeschützter Platz zum Sitzen – das ist Luxus in dieser Jahreszeit. Denn Pausen im Freien sind kaum möglich: zu kalt, zu windig, zu rau.
Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter, immer weiter durch flaches Land. Mein eigentliches Ziel ist Sahagún. Doch wie es der Camino manchmal will – oder der Teufel – sind an diesem Wochenende sämtliche Herbergen geschlossen. Zettel an den Toren verweisen freundlich, aber bestimmt auf das nächste Dorf. Am Vortag noch hatte ich in Carrión eine Pilgerin getroffen – sie war mit dem Rad unterwegs zurück nach Burgos – und versicherte mir, in Sahagún sei alles offen. Also hatte ich mich auf ihr Wort verlassen und nicht weiter nachgeforscht.
Nun stehe ich da. Es hilft nichts – ich muss weiter. Zwar trage ich einen guten Schlafsack bei mir, eine aufblasbare Matte und den Poncho, der auch als Biwaksack taugt. Aber bei Minustemperaturen im Freien zu schlafen, das möchte ich mir doch ersparen. Also beiße ich die Zähne zusammen und hänge noch einmal zwölf Kilometer dran. Vorsichtshalber rufe ich vorher in der nächsten Herberge an – und zum Glück, sie hat offen. Um kurz nach 19 Uhr komme ich an. Wären es acht Kilometer mehr gewesen bis zur nächsten Unterkunft – ich hätte kampiert. So aber wartet ein Bett. Und ich falle hinein, dankbar bis in die letzte Faser.
Da ich schon so im Gehen drinnen bin, gehe ich am nächsten Tag die 47 km bis nach Leon. In der mir bekannten Albergue de la Benedictinas quartiere ich mich ein. Ich freue mich den mir schon bekannten Hostaliero Lukas zu sehen, der immer im Winter hier die Stellung hält. Ich übergebe ihm meine gesamte Wäsche zum Waschen und sitze in der Regenhose und im Anorak beim Essen. Nach einer Stunde bekomme ich die Wäsche gewaschen und getrocknet zurück und ich rieche wieder gut.
Danach gehe ich durch Leon, esse und trinke heiße Schokolade mit Churros und schlendere herum. Dann lege ich mich hin und raste mich aus, denn morgen möchte ich unter Umständen in einem Tag nach Astorga gehen, denn ich habe etwas vor.
An Astorga habe ich viele Erinnerungen. 2018 habe ich hier meinen Weg im Juli beendet und nach dem Reha-Aufenthalt im September wieder fortgeführt. Erinnerungen an 2018 habe ich öfter, besonders viele aber in den folgenden Tagen. Eine davon betrifft den Gaudi-Palast.
Schon viermal habe ich ihn von Außen gesehen, aber noch nie war es mir möglich, ihn von Innen zu besichtigen. Meine Hochsensibilität hinderte mich daran. Bevor ich zur Reise aufgebrochen bin, habe ich mir als Ziel vorgenommen, ihn zu besuchen.
Aber hat sich meine Wahrnehmung schon so gebessert, dass ich ihn mir zutrauen kann? Gesagt, getan, nehme ich mir einen Ruhetag in Astorga und reserviere diesen Tag nur für das Museum. Meine Sinne werden so angestrengt, dass für mehr kein Platz ist. Zu meinem Glück bin ich der einzige Besucher so früh am Morgen und kann mich voll und ganz auf den Besuch einlassen.
Museen kosten noch so viel Kraft, aber diesmal gibt es kein Zurück. Die Bauweise kommt mir allerdings entgegen, mit ihren großen Sälen und geschwungenen Formen. Es ist ein Bischofssitz, der allerdings nie benutzt wurde. Zahlreiche Ausstellungsstücke kirchlicher Natur und die Bauweise des Gebäudes werden erklärt.
Ich versuche, so viel wie möglich aufzunehmen – Eindrücke, Bilder, Gefühle. Und dann lasse ich es gut sein. Stolz erfüllt mich heute, denn ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Museum besucht. Ein kleiner Schritt, der sich groß anfühlt. Den Tag lasse ich entspannt im Café ausklingen, mit Blick auf das Leben draußen und einem warmen Gefühl drinnen.
Zurück in der Herberge lege ich mich hin und versuche, zur Ruhe zu kommen. Die Meseta liegt nun hinter mir – ein weiter, offener Raum, den ich durchschritten habe. Ab morgen beginnt ein neuer Abschnitt: Es geht hinauf in die Berge.
Ja, morgen geht es in die Berge. Schon von Astorga aus sieht man den Schnee weit herabreichen. Das heißt wohl, dass oben noch mehr liegt. Und Schnee ist immer eine besondere Herausforderung für mich. Ich spüre den Boden nicht wie andere, kann nicht zuverlässig einschätzen, wie fest ich auftrete. Auf hartem Grund geht es gut – da finde ich Halt, kann Druck geben, mich abstoßen. Aber Schnee oder weicher Schlamm nehmen mir diese Rückmeldung. Dann wird jeder Schritt zur Suche. Doch ich weiß inzwischen: Auch das lässt sich gehen – Schritt für Schritt, tastend, fühlend, im eigenen Rhythmus.
Dazu aber mehr im nächsten Bericht.
Nach einem wohltuenden Ruhetag in Pamplona breche ich früh am Morgen wieder auf, der Weg führt mich weiter in Richtung Burgos. Ich verspüre keine Eile, denn die heutige Etappe ist mit ihren 25 Kilometern bis nach Puente la Reina gut überschaubar. Der Körper ist ausgeruht, der Geist klar – der Camino Baztan liegt hinter mir, und ich spüre, wie gut mir diese Tage getan haben.
Den Sonnenaufgang am Alto del Perdón verpasse ich zwar erneut, doch das Licht, das mich auf dem Weg dorthin begleitet, ist nicht weniger eindrucksvoll. Wie schon in den Jahren zuvor taucht die aufgehende Sonne die Landschaft in eine Stimmung, die kaum in Worte zu fassen ist – warm, leise und voller Versprechen.

Zum ersten Mal achte ich nicht mehr so sehr auf die Bewegung und die Behinderung. Ich lasse das Leben mehr auf mich einfließen, und das Erleben bekommt einen neuen Stellenwert. Bisher war ich so sehr mit meiner Bewegung beschäftigt, dass das Leben nebenher stattfinden musste.
Seit dem therapeutischen Tanzen im letzten Jahr konnte ich einen entscheidenden Schritt nach vorne machen. Meine Wahrnehmung hat sich spürbar verbessert – ich erlebe das, was ich sehe, auf eine intensivere Art.

Der Plaio del Alto ist immer wieder aufs Neue ein Erlebnis – die Aussicht und die Lichtstimmung sind einfach beeindruckend. Beim Aufstieg treffe ich einen Spanier, dem ich in den kommenden Tagen noch öfter begegnen werde. Wir verstehen uns gut, und es entstehen angenehme Gespräche. Solche Begegnungen sind für mich besonders wertvoll, denn sie helfen mir, den sozialen Kontakt zu pflegen.
Gleichzeitig merke ich: Mehr als drei Menschen um mich herum stressen mich. Doch gerade durch solche Situationen lerne ich – Schritt für Schritt – soziale Kompetenz. Es ist ein langsames, aber stetes Weiterkommen.
Am Übergang des Alto del Plaia öffnet sich der Blick weit ins Land – dorthin, wo mein Weg mich in den nächsten Tagen noch führen wird. Solche Fernblicke tun der Seele gut. Deshalb ist es so wichtig, hinauszugehen und ins Weite zu schauen. Nach dem Alto del Plaia folgt wieder der bekannte, berüchtigte Schotterweg hinunter. Diesmal muss ich weniger darauf achten, nicht umzuknicken – sondern eher darauf, nicht zu emotional zu werden.

2018 habe ich hier noch bei jedem Schritt vor Schmerzen geschrien – meine Knöchel waren noch so schwach, dass ich ständig umknickte. So sehr ich damals wieder leben wollte, so präsent sind auch die Erinnerungen an die Momente, in denen nichts glatt lief. Momente, die schwer und manchmal kaum auszuhalten waren.
Schritt für Schritt wurden sie erträglicher. Doch es brauchte Millionen und Abermillionen Schritte, bis es so weit war.
Zu groß waren die Eindrücke, denen ich damals ausgesetzt war. Erst heuer gelingt es mir zum ersten Mal, vieles besser zuzulassen, einzuordnen und zu verstehen.
Der Plaio del Alto war 2018 für mich ein echtes Hindernis – besonders der Abstieg hat mir damals großen Respekt eingeflößt.
Diesmal gehe ich – zumindest am Anfang – nicht so weit wie in den letzten Jahren. Ich lege keine großen Distanzen zurück. Eher langsam und verträumt bewege ich mich auf dem Weg und lasse mich ganz auf das ein, was die wunderschöne Landschaft mir bietet.
Das Weinbaugebiet Rioja, mit der Umgebung rund um Logroño, genieße ich in vollen Zügen. Immer wieder bleibe ich stehen, setze mich hin, trinke einen Kaffee – einfach so. Den Wein trinke ich nach wie vor selten, auch wenn mich die Weinhänge und der Anbau tief faszinieren.
Wenn es sich ergibt und ich ein geöffnetes Café finde, schreibe ich an meinem Buch weiter. Die Schreib-App am Handy und eine kleine faltbare Tastatur müssen genügen – mehr ist aus Gewichtsgründen nicht möglich. Bisher klappt das Schreiben erstaunlich gut, besser als erwartet.
In Logroño bleibe ich diesmal nicht, sondern durchquere die Stadt nur, um weiter nach Nájera zu gelangen. Es sind nur wenige Pilger unterwegs, und an diesem Tag begegne ich keinem einzigen auf dem Weg.
Hier wird es erst recht spät hell – viel später, als ich es von zu Hause gewohnt bin. So breche ich fast immer als einer der Ersten aus der Herberge auf, noch im Dunkeln. Während die anderen Pilger noch beim Frühstück sitzen, erlebe ich das Erwachen des Tages draußen, in der Stille der Natur.
Ein Morgen ist schöner als der andere – und keiner gleicht dem nächsten. Es ist zwar oft kalt, doch die Natur entschädigt für so vieles. Es ist meine liebste Zeit am Camino, wenn die Sonne beginnt, sich langsam über den Horizont zu schieben.
Diese Momente erinnern mich oft an meine Zeit im Krankenhaus. Monatelang konnte ich nur den Kopf zur Seite neigen, hin zum Fenster – und den Tagesbeginn beobachten, ohne hinausgehen zu können. Vielleicht erlebe ich den Morgen deshalb heute so intensiv – wie kaum etwas anderes.
Jeder Morgen ist ein neuer Anfang. Er erinnert mich daran, den Tag voll auszukosten – egal, was kommt. Selbst in dunklen Momenten versuche ich, etwas Positives zu sehen – und halte daran fest. Nicht jeder Tag beginnt mit Sonnenschein. Manchmal ist es bewölkt oder es regnet – sinnbildlich für das Leben. Doch gerade dann gehe ich oft fröhlich summend oder sogar laut singend meinen Weg weiter. Dann scheint die Sonne eben in mir – denn ich darf einen neuen Tag erleben. Unabhängig vom Wetter oder der Lage um mich herum.
Bei Sonnenaufgang unterwegs zu sein, zählt für mich zu den schönsten Erlebnissen am Camino. Manchmal staune ich, wenn mir jemand erzählt, er habe noch kaum einen gesehen – weil er einfach später aufsteht. Auch das gibt es am Camino. Jeder, wie er mag.
"Jeder erlebt das, was er braucht – nicht, was er sich wünscht."
Ein Spruch vom Camino – und einer, der für mich oft sehr wahr geworden ist.

Im Winter haben viele Bars geschlossen, und die Dörfer wirken oft wie Geisterstädte. Manchmal sind es viele Kilometer bis zur nächsten Möglichkeit, ein Frühstück zu bekommen. Dann heißt es: sich auf einer Bank niederlassen, es sich irgendwie bequem machen – und trotz der Kälte etwas zu sich nehmen.
Oft ziehe ich es jedoch vor, im Gehen zu essen. Schon am Morgen bereite ich alles so vor, dass ich unterwegs nur noch in die Taschen greifen muss – Brot, Käse, etwas Wurst. Alles griffbereit. Nur eines fehlt mir dabei jedes Mal: der Kaffee. Mein Lebenselexier am Camino.
Aber das nächste Dorf kommt bestimmt – und dann wird der Kaffee einfach nachgeholt.
Bei Belorado erwischt mich ein leichter Regenschauer. Der Poncho ist griffbereit und schnell übergezogen. Es ist oft ein ständiges Auf und Ab – je nach Wetter. Meist sind es nur kurze Schauer in unregelmäßigen Abständen, die schnell wieder vorbeiziehen.
Mein Pilgerfreund Pau aus Spanien hat das Anlegen des Ponchos einmal so herrlich komisch beschrieben, dass der ganze Pilger-Tisch in Tränen vor Lachen ausbrach. Solche Momente bleiben – gerade an grauen Tagen.
"Ich blieb unter einer neugebauten Brücke stehen, um mir den Poncho anzulegen. Aber irgendwie schaffte ich es nicht, ihn über den Rucksack zu bekommen und ihn herunterzuziehen. Schlussendlich hängte ich mir den Rucksack auf die Arme, der Poncho über mir und vorsichtig versuchte ich den Rucksack hochzuziehen, aber ich verhedderte mich nur noch mehr in Rucksack, Poncho und mir selbst. Nach zehn Minuten Kampf gab ich erschöpft von den vielen Versuchen auf und ergab mich meinem Schicksal.
Erst da bemerkte ich eine Hebebühne, die auf der Brücke über mir stand. Zwei Bauarbeiter beobachteten meinen verzweifelten Versuch, den Poncho anzulegen. In Zeitlupentempo fuhr die elektrische Hebebühne mit einem Arbeiter zu mir herunter. Keine Regung in seinem Gesicht war während der gesamten Fahrt zu sehen, die rund zwei Minuten dauerte. Bei mir angelangt, der ich noch immer erschöpft am gleichen Punkt stand, stieg er aus, zog mit einem kurzem Griff meinen Poncho über den Rucksack, sagte nur "Itś ok!", stieg wieder ein und fuhr im Zeitlupentempo nach oben. Es war eine Slapstick Nummer vom Feinsten. Ich sah im nach, bedankte mich, bis er nach oben wieder entschwand und ging baff weiter."
Pilger Pau
Ja, solche Erlebnisse hält der Camino bereit für einen und macht selbst das Anlegen eines Poncho zum Erlebnis.

Da ich am nächsten Tag in einem Rutsch bis nach Burgos gehen wollte, suchte ich eine geöffnete Herberge, ein Stück hinter Belorado. Die Handy-Apps sind zwar hilfreich, zeigen aber nicht immer verlässlich an, ob eine Unterkunft tatsächlich offen hat. Da ich mich mit dem Telefonieren noch immer etwas schwertue, gehe ich meist auf Vertrauen los – und wurde bislang nie enttäuscht. Bisher habe ich immer etwas gefunden.
Da ich in Espinosa schon im Februar 2020 genächtigt hatte, wollte ich auch diesmal mein Glück dort versuchen. Beim Herumstöbern am Handy entdecke ich eine Herberge – in Gedanken darauf vorbereitet, dass es sich um dieselbe wie damals handelt. Es gibt die Möglichkeit, per WhatsApp zu reservieren, also schicke ich auf gut Glück eine Nachricht. Und tatsächlich – kurz darauf kommt eine Antwort: Es ist ein Bett frei.
In Espinosa angekommen, stelle ich fest: Es ist nicht die mir bekannte Herberge, sondern eine neue – gleich nebenan. Sie wird von Sabine und Ulrich aus Deutschland geführt, die mich herzlich empfangen. Das Haus ist auf angenehme Weise eingerichtet, warm und offen – ich fühle mich sofort wohl. Die beiden hatten schon zuvor eine Herberge geführt und haben auch hier wieder einen Ort geschaffen, an dem man gerne bleibt.
Für mich ist es ideal zum Schreiben – ruhig, freundlich, inspirierend. Später treffen auch Pau ein und die beiden Koreanerinnen, Sunny und Maria.
Schon beim Weggehen im Finsteren liegt Schnee, dabei wartet die lange Querung eines Gebirgszuges nach Villafranka noch auf mich. Im ersten Morgenlicht erreiche ich den Fuß des Berges. Eine tolle Winterstimmung auf den ersten Metern bergauf, lässt mich den Anstieg beginnen. Die folgenden zwölf Kilometer durch den Wald, lege ich durch Schnee zurück.
Normalerweise tänzle ich hier zwischen tiefen Schlammlöchern, diesmal ist aber alles gefroren. Ich bin früh genug dran, dass die morgendliche Kälte alles gefrieren lässt. Da heute ein sonniger Tag wird, werden es die nachfolgenden mit tiefem Boden und Schneematsch zu tun bekommen.
Zu Mittag bin ich in Atapuerca, einem Fundort der Neandertaler. Am Crux de Atapuerca, einer Hügelüberquerung, verweilte ich fast eine halbe Stunde am Kreuz. Tiefe Emotionen begleiten mich, denn wieder einmal wird mir mein Weg von 2018 bewusst und damit auch die Folgen der Krankheit.
Jeder Schritt war damals wie beim Höhenbergsteigen – und erschöpft erreichte ich schließlich das Kreuz auf der Höhe. Dort legte ich meinen ersten Stein nieder. Ich kroch mehr, als ich ging. Ich wusste nicht, wohin mein Leben führen würde und ob ich jemals wieder ein "normales" Leben würde führen können. Diese wenigen Höhenmeter fühlten sich an wie der Mount Everest.
Heute gehe ich denselben Anstieg – trotz Muskelschwäche und neurologischer Einschränkungen – ohne Schmerzen. Viel sicherer als damals.
Trotz all der Schmerzen, der Gefühllosigkeit in den Füßen und den vielen Handicaps war ich damals so glücklich wie schon lange nicht mehr. Ich war überzeugt, dass ich alles schaffen konnte – auch wenn es Zeit brauchen würde. Die Folgen des Hirntumors hatten mir anfangs keine guten Aussichten gelassen. Doch mit der Fahrt zu meinem ersten Camino Francés 2018 nahm mein Leben eine unglaubliche Wendung.
Auf dem Weg nach Burgos war ich einfach nur glücklich. Das Gehen fiel mir leicht, und ich war voller Freude darüber. Ich „tanzte“ regelrecht auf dem Weg – ein Gefühl, als wäre ich in einem neuen Leben angekommen.
Natürlich weiß ich, dass solche Zustände nicht ewig andauern. Es kann schnell anders werden. Aber entscheidend ist das Jetzt – und diesen Zustand so gut wie möglich zu erleben.
Ich merkte, dass das viele Schreiben manche alten Themen an die Oberfläche brachte – besonders Erinnerungen aus der Zeit im Krankenhaus. Deshalb verlagerte ich meinen Fokus wieder mehr aufs Gehen. Und das werde ich auch in den nächsten Tagen beibehalten.
Schon im letzten Jahr hatte ich hier Erfahrungen mit dem Wiederauftauchen alter Traumata. Damals wie heute ist das Gehen meine beste Antwort darauf – es hält mich ganz im Hier und Jetzt.
Nur nicht wieder in Gedankenspiralen geraten, aus denen es kein Weiterdenken gibt – wie im Vorjahr. In der Freude zu bleiben, im Glücklichsein – das ist die beste Therapie. Und genau das schenkt mir das Gehen.
Mein Gehirn schützt mich noch davor, mich tiefer mit gewissen Themen befassen zu müssen. Es ist kein Verdrängen – sondern ein Vertrauen darauf, dass alles zu seiner Zeit kommt. Wenn es so weit ist, werde ich es aufarbeiten – und verstehen können. Bis dahin heißt es: Geduld haben. Und alles so nehmen, wie es ist.
Weiter geht es – links am Flughafen vorbei, in Richtung Burgos. Ich wähle eine Alternativroute, die viele nicht kennen. Statt entlang der verkehrsreichen Straße wandere ich an einem Fluss entlang, begleitet von einem Park und von Bäumen. Still, friedlich – genau richtig.

Der Weg führt mich bis kurz vor die Kathedrale von Burgos. Trotz der 50 Kilometer tun mir die Füße nicht weh.
Es ist kaum in Worte zu fassen, in welcher Gefühlslage ich mich befinde.
Ich bekomme ein Bett in der Herberge, gehe duschen – und fülle danach meine Vorräte auf.
Wieder zurück esse ich nur eine Tütensuppe – der große Hunger bleibt aus, dank der vielen kleinen Happen unterwegs.
In den kommenden Tagen auf der Meseta möchte ich mich wieder mehr aufs Gehen konzentrieren und weniger aufs Schreiben. Die Gefahr, dass dabei alte Traumata überhandnehmen, möchte ich nicht eingehen. Seit dem Hirnabszess folge ich konsequent meiner Intuition – und sie hat mich noch nie getäuscht. Darauf kann ich vertrauen.
Ein großer Dank gilt meiner Therapeutin Hanna Treu vom therapeutischen Tanzen. Bei ihr habe ich die meisten meiner Grundlagen fürs Leben gelernt. Am Camino habe ich nun die Möglichkeit, diese auch außerhalb des geschützten Rahmens anzuwenden – und genau so zu dosieren, wie es mir guttut.
Mein Winter-Camino 2020 war schon eine besondere Erfahrung – doch dieser hier, 2023, übertrifft ihn. Was sich seither – trotz Pandemie – in meiner Wahrnehmung verändert hat, ist unglaublich. Dieser Camino ist für mich eine Bestätigung meines Weges. Und das therapeutische Tanzen hat daran einen großen Anteil.
Wenn ich heute daran denke, wie mir eine Ärztin 2017 sagte, dass sich nicht mehr viel verbessern werde – weil die meisten Fortschritte im ersten Jahr nach der Erkrankung passieren würden. Damals schaffte ich am Tag insgesamt 300 Meter, mit vielen Pausen – ich war ein Pflegefall.
Es hat lange gedauert, viele Jahre und viel Training. Aber seit 2019 – mit dem Beginn der Tanztherapie – hat sich ein neues Kapitel aufgetan. Ein Weg in ein neues Leben.
Alles, was ich in dieser Zeit gelernt habe, werde ich nun auf der Meseta umsetzen. Ich werde meinem Gefühl folgen und tun, was mir guttut. Bis Burgos hat es schon ganz gut geklappt.
Doch davon – mehr im nächsten Bericht.
Der Camino Baztan war für mich die perfekte Alternative, um zum Camino Frances zu gelangen. Direkt von der Küstenstadt Bayonne aus schlängelt sich dieser Weg durch malerische Landschaften, führt über die sanften, im Winter dennoch fordernden Pyrenäen, und bringt mich schließlich nach Pamplona – an jenen Ort, an dem der bekannte französische Jakobsweg beginnt.
Sechs Etappen sind vorgesehen, doch der Winter schreibt seine eigenen Regeln. Ich plane vier Tage. Genaueres dazu später.
Was diesen Weg für mich so besonders macht, ist die Vielfalt, die er schenkt: Küstenabschnitte, grüne Täler, uralte Wälder und bergige Passagen wechseln sich ab. Eine Strecke, wie gemacht für jene, die nicht nur Strecke machen wollen – sondern unterwegs auch sich selbst begegnen möchten.
Seit meiner Reha nach dem Hirnabszess ist mir bewusst geworden, wie eng Körper und Geist miteinander verwoben sind. Und genau diese Verbindung möchte ich auf dem Camino Baztan weiter stärken. Die körperliche Anstrengung, das Gehen, das tägliche Weiterziehen – gepaart mit der geistigen Herausforderung, sich immer wieder auf Neues einzulassen, unbekannte Wege zu betreten, Wind und Wetter zu begegnen – es ist diese Kombination, die mich aufrichtet.
Ich bin zuversichtlich, dass mir diese Reise nicht nur helfen wird, meine körperliche Kraft weiter aufzubauen, sondern auch meine geistige Beweglichkeit zu schärfen. Jeder Schritt auf dem Weg ist ein Schritt zurück ins Leben. Manchmal einen Schritt näher zu mir selbst.

Um 8h30 kommt mein Bus in Bayonne an und mein erster Weg führt mich zur Kathedrale. Einen Stempel suche ich vergebens und auch das einzige geöffnete Café kann mit keinem dienen. Da ich nicht zu viel Zeit verlieren möchte, starte ich bald darauf. Zuerst mache ich mich im Café noch fertig zum Gehen, nach der langen Busfahrt.


Durch Bayonne hindurch, geht es vorbei an alten Festungsmauern zum Beginn des Weges. Am Fluss Nive, an dem ein Fuß- und Radweg entlang führt, schlängeln sich die ersten 10 Kilometer den Weg am Flusses entlang, auf dem sich zahlreiche Radfahrer und Nordic Walker tummeln. Auf dem Fluss sind die Ruderer unterwegs.
Da es flach ist, komme ich schnell vorwärts. Danach geht es leicht bergauf und bergab und ich entschließe mich, bis nach Spanien, nach Urdax, zu gehen, um im Kloster zu nächtigen. Alles in allem rund 36 Kilometer. Allerdings sollten es dann um einige mehr werden.

Mit dem ersten Berg habe ich mich bereits ordentlich vertan. Kombiniertes und verschränktes Denken ist für mein Gehirn nach wie vor ein Defizit, dass ich bisher nicht beheben konnte. Die Orientierung ist mir das schon des Öfteren zum Verhängnis geworden, so auch dieses Mal.
Der Weg ist bisher an und für sich sehr gut gekennzeichnet, aber eine Tafel am Berg verwirrt mich. Ohne viel darüber nachzudenken, biege ich nach rechts ab und folge dieser Markierung. Das Jakobsweg Zeichen und die Camino Aufschrift bestärken mich. Allerdings ist ein anderer Camino gemeint, die richtige Strecke sollte für mich geradeaus weiter führen. Auf die Idee, dass hier noch ein anderer Camino kreuzt, komme ich nicht.
Ehe ich mich versehe, lande ich in einem Seitental, auf unwirtlichen Wegen. Plötzlich bin ich auch ohne weitere Wegweiser oder Markierungen unterwegs. Zurückzugehen ist zu weit, so nehme ich den ersten Weg wieder zurück hinauf auf die Höhe und schlage mich teilweise querfeldein durchs Gebüsch. Immer höher steige ich, um zurück zum Camino zu gelangen.
Nach einer anstrengenden Strecke bergauf durch den Wald treffe ich auf Markierungen. Zwar bin ich wieder in die falsche Richtung unterwegs, aber zumindest auf einem Weg. Nach über 15 Kilometer Umweg, teils über Landstraßen, komme ich wieder auf den Camino Baztan und bin unterwegs nach Urdax, zum Kloster. Dort treffe ich erst um 19 Uhr ein.

Hier bin ich der einzige und gleichzeitig auch der erste Gast in diesem Jahr in der Herberge. 52 Kilometer stehen am Ende des Tages zu Buche. Die Herberge ist nicht geheizt, aber es gibt eine Mikrowelle, in der ich eine Suppe mache, die meine einzige warme Mahlzeit an diesem Tag ist.
Am zweiten Tag stehen rund 30 Kilometer am Programm, mit einer Bergüberquerung in rund 600 Meter Seehöhe. Gestartet bin ich am Vortag auf Meereshöhe. Nach einer kalten Nacht geht es im ersten Morgengrauen los. Ich bin jetzt mitten in den Pyrenäen und der Weg führt auf und ab. Am Pass stapfe ich nur die letzten 50 Höhenmeter im Schnee, denn die Schneegrenze liegt bei ungefähr 600 m.
Auf der anderen Seite geht es wieder runter und bald bin ich im Dorf, wo es eine Herberge geben soll. Ich telefoniere und zehn Minuten später wird mir aufgesperrt. Wieder bin ich der einzige Gast und im Steinbau ist es deutlich kälter, als draußen im Freien. Kein gutes Zeichen für die Nacht, denn ich gehe zum Aufwärmen nach Draußen. Wahrscheinlich wäre Biwakieren wärmer gewesen.
Zunächst noch kurz bergab, führt die weitere Strecke für lange Zeit nur mehr bergauf. Ab rund 600 Meter Seehöhe beginnt wieder der Schnee. Die letzte Abzweigung auf die Straße hinaus lasse ich aus und folge der Markierung des Weges im Wald. Die Straße wäre die Alternative bei zu viel Schnee gewesen, der noch nicht so hoch liegt. Am Puerto de Otsondo bin ich oben angelangt, aber noch nicht am Ende. Kilometerlang zieht es sich noch am Höhenrücken dahin.
Zunächst nur stapfen, ändert es sich aber bald in tiefes Spuren. Es wechselt ab, zwischen tiefen und weniger tiefen Schnee. Harschiger Schnee erschwert das Vorwärtskommen, immer wieder breche ich ein und stecke meist mit einem Bein bis zur Hüfte fest. Mühsam winde ich mich heraus. Zehn Kilometer wird diese Tortur dauern, das ich als willkommenes Training sehe. Zwar nicht erwartet, aber genau deswegen bin ich hier.
Auf den Spuren von Skitourengehern wandle ich dahin. Über 900 Meter Seehöhe erreiche ich, überwiegend im tiefen Schnee spurend. Ich freue mich, als es endlich bergab geht. Trotzdem hat die Plackerei kein Ende. Zwischen Schnee, Schlamm und tiefem Morast komme ich nur langsam nach unten.
Nach vielen Stunden im Schnee erreiche ich das Dorf Amairu. Allerdings hat alles geschlossen, so früh im Jahr geht eben niemand diesen Weg. So ziehe ich weiter bis Olagüe, wo die nächste Herberge wartet.
In Berroeta bin ich um 13h30. Der Anblick der Herberge lässt mich gefrieren. Noch eine weitere Nacht in so einem kalten Steinbau lässt mich gefrieren und dazu habe ich kaum mehr Verpflegung. Nein, das möchte ich nicht und so entschließe ich mich, weiter bis nach Pamplona zu gehen, auch wenn es ein weiterer langer Tag wird. Bei herrlicher Abendstimmung erreiche ich Pamplona. Wieder sind es 49 Kilometer geworden.
Zu meiner Überraschung hat dort die Herberge Jesus y Maria geschlossen, sie wird als Obdachlosen-Quartier genutzt und ich muss mich nach einem anderen Quartier umsehen. Nach diesen 130 Kilometern in drei Tagen, nehme ich mir einen Rasttag in Pamplona. Weiter geht es dann am Camino Frances, unter hoffentlich besseren Bedingungen.
Jetzt raste ich erstmal aus, denn mein Gehirn war ordentlich gefordert. Mal sehen, ob es mir neue Synapsen gebracht hat. Zumindest mit dem Zurechtfinden wird es etwas besser und mit dem Meistern von Bedingungen.
Heute besuchte mich das Krafttier Amsel am Fenster. Sie setzte sich auf den Fensterrand und schaute durchs Glas ins Zimmer, während ich am Schreibtisch saß. Und das passierte noch mehrmals an diesem Tag.
Ein Krafttier kann in schwierigen Situationen oder auch einfach so in unser Leben treten und seinen Schützling in dieser Zeit unterstützen, beraten und stärken.
Die Botschaft, die mir die Amsel mitbrachte, passt genau zu meinem letzten Blogbeitrag und meiner derzeitigen Lebenssituation, in der es im Moment viel um die Natur geht.
"Meinen Träumen und Sehnsüchten soll ich nachspüren, da diese erweckt werden wollen. Veränderungen stehen an.
Ich soll mich bewusst an die Natur und dem eigenen Sein anbinden. Bewegung und Transformation wird in meinem Leben Einzug halten."

Es sind alles Themen, die mich schon seit Jahren begleiten, besonders aber in den letzten Tagen.

"Wege suchen, um ins Unbekannte vorzudringen. Die Amsel hilft mir, meine innere Stimme besser zu hören und klarer zu sehen.
Mit Freude und Mut durchs Leben gehen und das Singen nicht vergessen. Meine dunklen Anteile anerkennen, denn sie gehören zu mir."
Seit dem Hirnabszess ist mein Lernen so vielfältig und Krafttiere weisen mir manchmal eine Richtung, in die ich noch hinschauen kann oder besser gesagt, sollte.

"Die Amsel kommt in dein Leben und bringt dir Langsamkeit, Geduld und Selbstvertrauen.
Auf deinem Weg ist es gerade stimmig. Still sitzt du da und ruhst dich aus. In dieser Stille erkennst du deine Schätze. Würdige sie und liebe sie.
Manchmal versteckst du dich mit deinen Gaben und es ist gut so. Erlaube es dir. Das Neue ist noch so jung, dass es wachsen darf. Jetzt vertraust du deinem Gefühl und teilst mit anderen nur das, was wirklich geteilt werden will.
Erlaube es dir, so zu sein, wie du bist. Erlaube es dir, dass du ganz zu dir kommen darfst. In einer Langsamkeit, die zu dir passt.
Ruhe in deiner Mitte, Freude macht sich breit und lebe.
Deine Amsel"
Quelle: https://kathrinsieder.at/
Die Amsel singt besonders gerne bei Morgendämmerung. Der Gesang wirkt angenehm und harmonisch.
Sie zeigt uns Möglichkeiten auf, sich von alten Dingen loszulösen, die nicht mehr zur Lebenssituation passen und neue Projekte oder Ideen anzugehen.
Meine Rehabilitation kommt in eine neue Phase,
danke dir, liebe Amsel!

Draußen zu sein, ist mir seit dem Hirnabszess ein großes Bedürfnis geworden. Gehe ich nicht in die Natur, funktioniere ich nicht. Es macht allerdings einen großen Unterschied, wohin ich gehe?
Ob die Natur oder menschlich gemachte Strukturen, es macht einen großen Unterschied für meinen Körper, aber auch für den Geist.
Stadt - Land, Häuserfronten - Blumenwiese, alles hat seine eigene Wirkung. Der Hirnabszess hat mir damals alle Filter im Gehirn genommen, deshalb nehme ich auch alles in einer sehr feinsinnigen Form wahr.

Das Wort Fraktal ist wohl nur den wenigsten bekannt und war es auch für mich, bis vor kurzem. "Fraktale" werden Muster in der Natur genannt, wie zum Beispiel das Muster eines Farnes, das besonders starke und positive Gefühle erzeugt und die Kraft hat, den Körper zu entspannen.
Im Gegensatz dazu gibt es menschlich gemachte Strukturen und Muster, an die sich der Körper nur schlecht gewöhnen kann und die in unseren Städten vorherrschen. Den meisten fällt das nicht mehr auf, aber wer einmal die Kraft der Natur kennengelernt hat, der lernt zu unterscheiden.

Früher einmal hat mir die Stadt, zumindest nicht offensichtlich, nicht geschadet und ich konnte mich problemlos darin bewegen, trotz Hochsensibilität. Mit dem Hirnabszess bekam meine Feinfühligkeit allerdings eine andere Dimension und ich habe seither alles neu zu lernen, besonders aber zu unterscheiden zwischen notwendigen und nicht notwendigen.
Fraktale Strukturen findet man im Gehirn, im Muskel, in den Luftwegen der Lunge und in Blutgefäßen, aber auch in Adern von Pflanzen, Ästen und Wurzeln. Deswegen ist die Natur so wichtig für uns, denn wir sind Natur.


Im Krankenhaus lernte ich die Technik, wieder 30 bis 50 Meter am Stück zu gehen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wichtig es für mich war, vom ersten Moment an, wieder Gehen zu erlernen. Gehen ist für mich ein Synonym für Bewegung. Gehen bewegt, Körper wie Geist!
In den letzten zwei Wochen meines Krankenhaus-Aufenthaltes durfte ich erstmals ohne Begleitung gehen, denn bis dahin, also über vier Monate lang, durfte ich ohne das Beisein einer Krankenschwester nicht einmal alleine vom Bett aufstehen. Die Gefahr, ohnmächtig zu werden und mich dabei zu verletzen, war zu groß. In diesen letzten zwei Wochen bewegte ich mich dann zum ersten Mal seit Monaten alleine im Freien.
Wenige Tage vor meiner Entlassung, schaffte ich einen 250 Meter langen Rundgang im Freien, mit vielen Pausen, alleine und voll am Limit. Auf halber Strecke gab es eine Parkbank, auf der ich mich 15 Minuten hinsetzen musste, bevor ich den Rest in Angriff nahm. Schon damals bemerkte ich den so positiven Einfluss der Natur, stärker als je zuvor.
Gegenüber der neurologischen Station beginnt der Leechwald, wo früher mein Trainingsgebiet für das Radquerfeldeinrennen war. Die Bäume, auf die ich in den letzten Monaten nur durch das Fenster schauen konnte, waren plötzlich so nahe. Berühren konnte ich sie nicht, denn das Gehen war so anstrengend und die wenigen Schritte durch die Wiese zu den Bäumen, war für mich noch nicht machbar.
Trotzdem war ich glücklich wie nie zuvor. Noch unbewusst nahm ich schon damals die Natur als besonders heilsam wahr, hatte aber noch keine Ahnung davon, welch große Rolle sie in meiner weiteren Rehabilitation spielen sollte.
Meine Hochsensibilität hatte ich vor dem Hirnabszess sehr gut im Griff und konnte sie auch beruflich gut nutzen, zum Beispiel als Energetiker. Nach dem Hirnabszess bekam ich aber auch die nicht so guten Seiten zu spüren. Alles, was vorher keine Probleme bereitete, war auf einmal nicht mehr möglich, belastete mich riesig und raubte mir die wenige Energie, die ich vorrangig zum Überleben brauchte.

Draußen in der Natur hingegen fühle ich mich wohl und komme trotz der Belastung beim Gehen, innerlich gestärkt zurück. Gehe ich in die Stadt, ist es genau umgekehrt. Nur ein kurzer Aufenthalt raubt mir Energie, trotz vorsichtigem Verhalten.
Das hat mich schon immer stutzig gemacht, dass der Unterschied so groß war, aber ich trainierte die ersten zwei, drei Jahre daran, das zu verbessern. Vorrangig versuchte ich mich wieder der Stadt auszusetzen, mit mäßigem Erfolg. Allein das Straßenbahnfahren bleibt bis heute ein schwieriges Unterfangen.

Und da wären wir wieder bei der Inklusion. Selbst heute noch brauche ich einen Sitzplatz in der Straßenbahn, denn das Ruckeln verträgt mein Körper nicht und lässt mich leicht umfallen. Mein Gehirn kann die sich so schnell verändernden Gleichgewichtsverlagerungen nicht schnell genug ausgleichen. Allerdings, wer sieht mir das an und bietet mir seinen Sitzplatz an?
Das sind die unsichtbaren Behinderungen, mit denen weit mehr Menschen zu tun haben, als allgemein bekannt ist. Inklusion bedeutet auch, andere Menschen Vorurteilsfrei anzunehmen. Da haben wir noch eine Menge aufzuholen.
Besonders am Jakobsweg blieb es bis zum Schluss eine Herausforderung, mich durch eine Stadt zu bewegen. Mit "die Stadt", meine ich auch, Museen zu besuchen, ins Kino gehen oder durch die Altstadt schlendern. Das alles sind "Anstrengungen", mich wieder daran zu gewöhnen. Es ist nur in "sehr" kleinen Schritten möglich.
Wobei ich die Worte "Anstrengung, Kämpfen, Problem und noch manch anderes", versuche zu vermeiden, da sie negativ behaftet sind. In der Pandemie habe ich mich dann, "gezwungenermaßen", entschlossen, die Stadt sein zu lassen und mich besser ganz der Natur zu widmen, deren positiver Effekt mir besser tut und ich mir mehr Fortschritte erhoffen kann, denn es geht um mehr, als nur mich wieder in der Stadt bewegen zu können.
Deshalb setzte ich mich auf meinem letzten Camino France auch lieber den Elementen der Natur aus, als den Unbilden der Stadt. Draußen unterwegs zu sein bedeutet mir viel und mein Spüren bekommt dabei eine andere Dimension. Die zwölf Tage Dauerregen am Schluss des Camino waren, trotz der Belastung, unglaublich heilsam für mich. Ich bin so froh, dass draußen erleben zu dürfen, dass Regen mir nichts anhaben kann. Ich tanze singend durch den Regen!

Ich fühle mich noch immer wie eine vertrocknete Blume, die im Regen wieder die Chance bekommt, aufzugehen. Deshalb gehe ich auch gerne im Regen.
Beim Klettern verbinde ich mich mit den Händen zur Natur, was mich erdet. Nach meiner Rückkehr vom Jakobsweg in Spanien, tat ich mich schwer mit der Umstellung auf zu Hause und ich fühlte mich unrund und nicht geerdet. Da war der Weg zum Zigeunerloch genau das richtige, um zu Klettern, bzw. zu Bouldern, um mich mit der Erde zu verbinden.

Diese gewaltige Fels Formation fasziniert mich immer wieder und diesmal habe ich auch eine Bezeichnung dafür, nämlich Fraktal. Diese natürlichen Muster im Felsen, mit dem das Auge besonders gut umgehen kann, im Gegensatz zu unnatürlichen Linien, wie an Häusern. Ich könnte stundenlang darauf schauen.
Zuerst war mein Gang noch unsicher auf dem Weg dorthin, aber unter den gewaltigen Felsen fühlte ich mich gleich wohler. Ich legte Rucksack und Daunenjacke ab und lehnte mich mit den Handflächen an den Felsen, der zwar kalt war, aber eine unglaubliche Energie verströmte. Wer das nicht einmal selbst erlebt hat, der wird es kaum verstehen können.
Die Energie strömte durch meine Finger in jeden Bereich meines Körpers und ich fühlte mich sofort besser geerdet. Die Unsicherheit verschwand binnen Minuten und ich versuchte es sogar mit dem Klettern, allerdings in der Waagerechten, wie auch sonst immer.
Die Koordination zwischen unten und oben im Körper bereitete mir diesmal einige Schwierigkeiten, aber es tat so gut, mich im Felsen zu bewegen. Bewegen bewegt, das spürte ich diesmal besonders stark. An diesem Tag konnte ich viel vom therapeutischen Tanzen umsetzen, denn da geht es ja um Bewegen und Spüren. Gehirn und Bewegung gehören untrennbar zusammen.
Dieser Tag ist wieder eine Bestätigung für die jahrelange Arbeit an mir, besonders mit dem therapeutischen Tanzen. Es bildet die Grundlage für all meine Übungen und das Training. Viele kleine Steps bedeuten irgendwann einen größeren und mit vielen Großen, mache ich einen Schritt weiter in meiner Rehabilitation.

Gehen und Alleinsein, ist eine Kombination, die besonders wirkungsvoll für mich ist. Mit dem Alleinsein habe ich kein Problem und schon gar nicht, wenn ich allein gehe.
Der Mensch ist ein Wesen, das sich nach Beziehung sehnt, in einer Welt, die nicht verbunden und entwurzelt ist. Diese Entwurzelung habe ich nach dem Hirnabszess sehr stark gespürt und ich hatte/habe zum Lernen, wie ich mich wieder verwurzle und mit der Welt verbinde. Das Gehen nimmt dabei eine besondere Stellungen ein, mit all ihren Varianten.
Beim Alleinsein entwickle ich mein eigenes Tempo, mit all seinen Variationen. Mal schnell, mal langsam, immer im richtigen Tempo, wie ich mich gerade fühle. Mit diesen Tempo- und Rhythmusvariationen übe ich seit 2019, das ich damals im therapeutischen Tanzen kennengelernt habe.

Als Hilfe für eine verbesserte Wahrnehmung nehme ich mir den Fotoapparat und fotografiere, was mich interessiert. So erstelle ich mir eine Fotostrecke, die ich mir ausdrucke und jederzeit auf meinem Schreibtisch analog anschauen kann. So hole ich mir Fraktale ins Heim und kann mich jederzeit damit verbinden, indem ich sie anschaue. Da ich ein visueller Typ bin, arbeite ich viel mit Fotos, die mir guttun.
Dieses fokussierte Beschäftigen damit, was mir guttut, ermöglicht mir die Sicht durch das Objektiv. Das alles passiert draußen in der freien Natur und so lerne ich auch, mit dem Fotoapparat umzugehen. Filmen geht noch nicht, mein Gehirn ist zu schnell damit überfordert. Auch Malen kann eine solche Fokussierung sein.
Sehr entscheidend ist, ob ich alleine gehe oder in Begleitung. Beides hat eine unterschiedliche Wirkung. Im Moment gehe ich die meiste Zeit alleine, ich bin dabei mehr mit der Natur verbunden und nehme alles anders wahr, als mit Begleitung.
Es war ein nasser. kalter und regnerische Tag, mit tollen Aussichten, trotz des Nebels. Die Bilder sprechen für sich.
Im Gegensatz dazu ein Spaziergang durch Frohnleiten, bei Sonne, aber mit Kälte. Auch hiervon wieder mit Fotos. Ich füge auch Bilder der Stadt ein, da kann jeder die Wirkung von Fraktalen an sich ausprobieren und ob man es überhaupt wahrnimmt oder wie sich Strukturen von Häusern und der Stadt anfühlen, als Gegensatz zu Wald und Blumen?





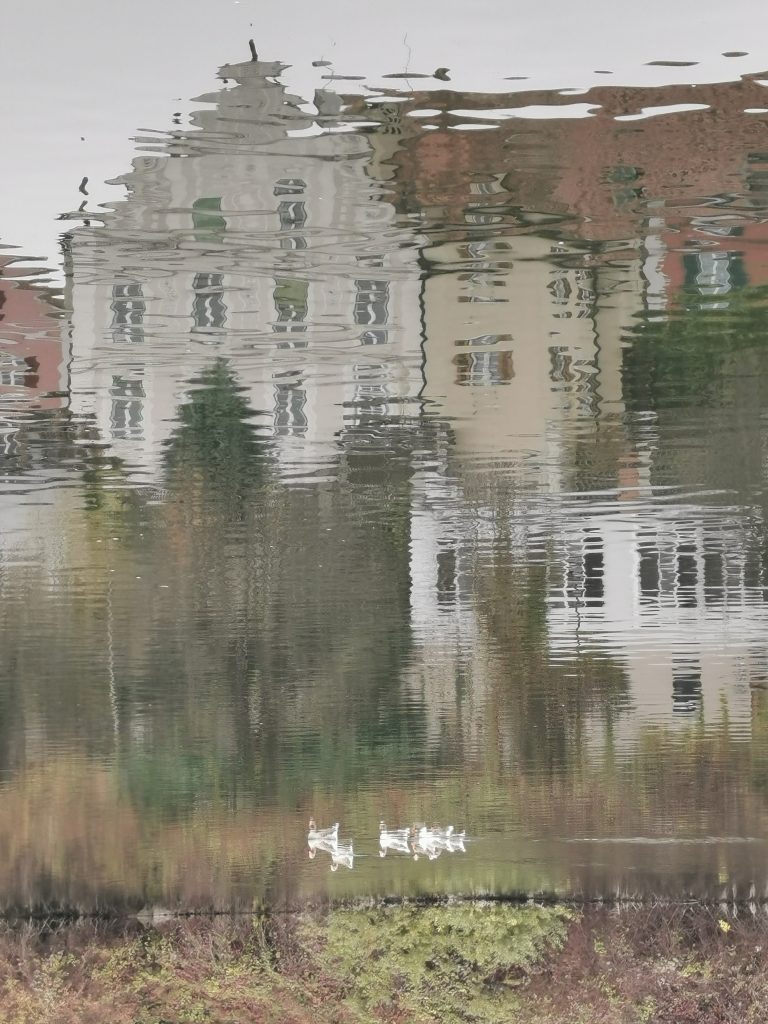




Seit ich mich noch mehr "draußen" in der Natur aufhalte, stabilisiere ich immer besser meinen Zustand. In der Stadt muss ich mehr aufpassen oder mich dem erst gar nicht dem aussetzen.
Ob Sonne oder Regen, ich nutze eigentlich jeden Tag, um in die Natur zu gehen und sie in mir aufzunehmen. Mein Gehirn profitiert davon und wird BEWEGT!
Am Camino Frances spüre ich immer wieder ein besonderes Lebensgefühl, immerhin hilft er mir seit Jahren, wieder mehr ins Leben zu kommen. Er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, denn er zeigt mir Lebensgefühle auf eine Art, wie es kaum eine Therapie bisher besser vermochte, ausgenommen das therapeutische Tanzen.
In der Pandemie bekam ich zu spüren, wie sehr mir der Camino bisher geholfen hat. Jetzt heißt es viel Nachzuholen für mich, denn die Corona-Zeit hat mir in meiner Rehabilitation gesundheitlich viel gekostet, mehr als ich mir am Anfang eingestehen wollte.

Jeder Camino hatte bisher eine andere Lernaufgabe für mich, vom Gehen lernen, bis dahin, wieder mit anderen Menschen kommunizieren zu lernen oder überhaupt, mit dem Leben wieder zurecht zu kommen. Diesmal stand die Wahrnehmung im Außen im Vordergrund, die viel mit dem Lebensgefühl zu tun hat. Es war diesmal weniger das Gehen, den das ist sowieso immer dabei.
Über allem steht ein positives und glückliches Lebensgefühl, sowie überhaupt eine positive Lebenshaltung, denn diese ist das Wichtigste, wovon Rehabilitation abhängt. Denn nur unter positiv gestimmten Zellen ist Heilung möglich, was immer auch Heilung für jeden einzelnen bedeutet!
Dieser Herbst-Camino, mein insgesamt fünfter und davon der vierte auf dem Camino Frances, brachte mich wieder ein ganzes Stück näher ans Leben. Ein wichtiger Part war darin, dass mich mein Sohn Elvin begleitete. Es war die erste gemeinsame längere Zeit seit dem Hirnabszess mit ihm zusammen und daher etwas besonderes.

Es war schön zusammen mit ihm am Camino unterwegs sein zu dürfen und ist eine Zeit, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. Die Überquerung der Pyrenäen, in den Herbergen, das Leben allgemein als Pilger, es hat einen solchen Wert das zu erleben und für mich war es schön ihm zeigen zu können, was mir in den letzten Jahren nach dem Hirnabszess so sehr geholfen hat.
Es ist für uns beide eine Lebensschule, für ihn ein Abenteuer und für mich wird meine Wahrnehmung besonders gefordert, wenn ich auf jemanden achten soll. Das bin ich nicht gewohnt und ich muss aufpassen, nicht zu viel zu wollen. Da spielen natürlich auch Emotionen und Gefühle mit, denn Null bringt mich derzeit meist besser durchs Leben, als Hundert Prozent.
Das zu differenzieren, ist oft noch schwierig für mein Gehirn. Trotzdem möchte ich wieder lernen Zwischenstufen zu ermöglichen, denn nichts ist schädlicher, als Emotionen zu verdrängen. Ist es noch ein Schutz oder nur Verdrängung, das ist oft die Frage?
Noch ist es oft ein Schutz, denn mit manchem kann und soll ich mich nicht befassen. Meinem Gehirn ist es nicht möglich gewisse Dinge zu verarbeiten, auch wenn ich möchte. In so einem Fall muss ich meinem Herz vertrauen, dass es das richtige für mich wählt und darf hier nicht auf den Verstand hören.
Leider machte die Achillessehne von Elvin nicht lange mit und so verließ er mich nach 10 Tagen in Logrono. Es war aber auf jeden Fall bis dahin ein Abenteuer für ihn. Für mich war es gut zu erleben, wie er mit den entsprechenden Situationen umging, denn es geht am Camino, so wie im täglichen Leben, eigentlich nur um das Hauptsächliche:
Walk - Eat - Sleep, Repait!
Alles andere ist nur Draufgabe, wenn diese drei Grundbedürfnisse befriedigt sind. Mit "Walk" ist auch "Bewegung" gemeint, in die auch sinnvolle Arbeit fällt. Man bekommt am Camino einen schärferen Blick dafür, worin man gut ist, was einem gefällt und wo man hin möchte. Das kann in jungen Jahren eine gute Orientierungshilfe sein.
An erster Stelle steht das Lebensgefühl, dass im Idealfall positiv ist. Damit ich es positiv wahrnehmen kann, dazu ist meine innere und äußere Wahrnehmung wichtig, wo ich noch viel Aufholbedarf habe.
Wikipedia hat eine gute Zusammenfassung:
"Wahrnehmung ist bei Lebewesen der Prozess und das subjektive Ergebnis der Informationsgewinnung und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und aus dem Körperinneren. Das geschieht durch unbewusstes Filtern und Zusammenführen von Teil-Informationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken."
Wikipedia
Puuhhh, na dann! Wenn ich das lese, wird mir ganz schummrig, denn dieses Zusammenführen aller Aspekte ist meine Herausforderung, die es zu lernen gilt und funktioniert noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Es ist aber entscheidend dafür, wieder ins Leben zu kommen.
Anfangs konnte ich ja kaum mit anderen Menschen, schon gar nicht mit Fremden, ein sinnvolles Gespräch führen. Dafür war der Camino hervorragend geeignet, mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Man wird dort so akzeptiert, wie man ist und es wird auch verstanden, wenn man einmal seine Ruhe haben möchte oder gar nicht spricht.
Diesmal waren es nur wenige Menschen, mit denen ich gesprochen habe, denn mein Augenmerk lag eben auf der Wahrnehmung. Dazu kam, dass ich in den ersten zehn Tagen von meinem Sohn Elvin begleitet wurde, der meine ganze Energie und Aufmerksamkeit beanspruchte. Das bekommt man von Außen gar nicht so mit.
Ich bekomme es aber immer besser in den Griff, wenngleich Elvin auch anmerkte, dass ihm manches zu viel sei. So lerne ich immer mehr dazu, meine Emotionen und Gefühle besser zu steuern. Daran arbeite ich seit Jahren, aber ich musste zur Kenntnis nehmen, dass alles in sehr langsamen Schritten passiert, so wie auch alles andere. Auch wenn ich schon schneller gehen kann, bin ich noch immer in der Langsamkeit gefangen.
Ich fühle mich oft wie ein kleines Kind, das alles noch zum Lernen hat. Auf meine Frage an einen Arzt, als ich noch im Krankenhaus lag, wie lange ich zum Gehen lernen brauche, erhielt ich nur die Gegenfrage:
"Wie lange braucht ein Kind, bis es gehen kann?"
...und genauso wie mit dem Gehen, ist es mit allem anderen. Es braucht Zeit, aber auch den Willen, dranzubleiben. Dranbleiben, auch wenn Fortschritte lange nicht erkennbar sind, denn genau dort liegt der Punkt, wo die meisten aufgeben.

...sind meine besondere Herausforderung, denn alle meine Filter im Gehirn haben sich geöffnet. In der Natur habe ich sie mehr oder weniger im Griff, aber noch nicht in der Stadt. Da habe ich in der Corona-Zeit den größten Rückschritt machen müssen. Die Eindrücke dort sind zu intensiv, zu stark und ich kann es noch nicht ausreichend filtern, was mir guttut und was nicht. Es wird einfach alles zu viel.
Unterwegs am Camino hat mir oft geholfen, dass mein Sohn dabei war und ich mich dadurch leichter in und durch die Stadt bewegen konnte. Museen, Menschenandrang und größere Städte waren aber trotzdem nur schwer ertragbar. Leider war die Corona-Pandemie sehr stark daran beteiligt, da die vielen Maßnahmen, ob gut oder schlecht, mich in meiner Rehabilitation behinderten.
Ich kann es nicht oft genug betonen, dass ich es einzig meiner Tanz-Therapeutin Hanna zu verdanken habe, die mich so gut mit dem therapeutischen Tanzen durch diese zwei Jahre gebracht hat. Alle anderen Therapien waren beendet, eingestellt oder vieles war für mich nicht zugänglich. Da hatte ich das einzigartige Glück, mit der Tanz-Therapie so viele verschiedene Dinge abzudecken, den der Hirnabszess verursachte.
Aus diesem Grund war ich auf diesem Camino darauf aus, meine Wahrnehmung zu verbessern oder zumindest dorthin zu bringen, wo sie vor Corona war und dadurch ein gutes Lebensgefühl zu bekommen.
Ich konnte auf der einen Seite meine Wahrnehmung verbessern, was mir besonders in der Natur geholfen hat. In der Natur ist es auch deswegen einfacher, weil die Natur natürlich ist und der Körper mit weniger Stress reagiert.
Auf der anderen Seite war die Stadt, viele Menschen, Verkehr und öffentliche Nahverkehrsmittel, darin konnte ich mich nicht verbessern. Im Gegenteil, ich habe mich verschlechtert und das bekam ich am Camino sehr zu spüren. Mein jahrelanges Training vor Corona war dahin. Es bedarf erneut einer Menge Training, wieder dort hinzukommen, wo ich vor der Pandemie war.
Mein Highlight diesen Herbst-Camino war sicher, dass ich mich endlich einmal durch die Nacht bewegen konnte. Durch die reduzierte Tiefensensibilität oder Propriozeption muss ich normalerweise meine Füße oder den Weg vor mir sehen, um Unebenheiten zu erkennen und wie/wo sie auftreten. Darum tue ich mich in der Nacht besonders schwer.
Es ist seit Jahren mein Ziel, wieder mehr Automatik zu bekommen, um endlich mehr Lebensgefühl zulassen zu können. Diese Automatik hat sich in der Pandemie zurückgebildet, da mein Gehirn mit so vielen anderen Dingen beschäftigt war und ich es nicht kompensieren konnte.
Mein Tag für die Nachtwanderung beginnt in Santo Domingo de Calzeda. Ohne Tagesziel gehe ich erst einmal los, denn etwas als fix zu planen, ist mir unmöglich. Im Hinterkopf habe ich es schon, dass ich die Nacht eventuell durchgehen werde, allerdings habe ich doch recht Bammel davor. In Villafranka, 34 Kilometer nach meinem Aufbruch, entscheide ich mich, es doch zu versuchen. Ich sollte es nicht bereuen. Es wurde ein Erlebnis, dass mich wieder einmal weiterbrachte.
Immer wieder an die Grenze gehen, nur so kann ich weiterkommen und ich habe eine Menge Grenzen auszuloten und nachzuholen. Es ist natürlich in dieser Nacht auch eine gehörige Portion Euphorie dabei. Seit meinem ersten Camino träume ich davon, durch die Nacht gehen zu können, jetzt, nach vier Jahren, ist es endlich so weit.
Das Gehen gestaltet sich schwierig, ist aber nicht unmöglich. Es erweitert meinen Horizont ungemein, denn bisher war alles nur Theorie für mich, wenn ich meinte: "Dann gehe ich eben weiter und durch die Nacht."!
Bisher habe ich es vermieden, später als 18 Uhr noch unterwegs zu sein. Zu Hause gehe ich im Normalfall nie später als 15 Uhr, da schaue ich, dass alles erledigt ist. Meine Energie fällt um diese Zeit rapide ab, daher muss ich aufpassen. In Spanien fällt aber viel vom alltäglichen Kram weg, so bleibt mehr Energie fürs Gehen über.
Natürlich kann ich nicht öfters hintereinander so weitermachen, denn der Körper verlangt den verpassten Schlaf nach. So gehe ich in der Früh nur mehr bis ins nächste Dorf oder Stadt, nehme mir ein Bett in der Herberge und verbringe praktisch den restlichen Tag und die Nacht schlafend. Mein Körper verlangt noch immer mindestens zehn Stunden Schlaf am Tag, egal ob ich gehe oder nicht.
Auf dem Weg nach Burgos lege ich mich dreimal für eine Stunde hin. Sitzbänke am Weg, zusammengeschobene Stühle vor einem geschlossenen Café, ich verwende alles, was ich finde. Die Temperaturen sind für Oktober ganz ok, so brauche ich nur den dünnen Daunenanorak zum Schlafen.
Den Aufstieg zum Crux de Matagrande en Atapuerca absolviere ich mit dem Mond an meiner linken Seite und unter guter Beleuchtung, es ist nur wenige Tage vor Vollmond. Oben am Kreuz herrscht eine mystische Stimmung, die ich genieße. Es ist das erste Mal, dass ich diese Zeit im Freien verbringe, nicht einmal zu Silvester war ich bisher munter.
Um am Tag mehr Zeit zu haben, möchte ich diese Zeit gerne verlängern, also weniger Pausen brauchen. Auch hier gilt wieder, ich kann es nur Stück für Stück machen und ich kann oder besser gesagt, ich darf nichts überspringen. Manchmal versuche ich zu Hause mich auch am Nachmittag zu betätigen, aber Tätigkeiten am Abend sind mir bisher verwehrt geblieben. Der Camino gibt mir aber Hoffnung, dass sich das in Zukunft ändern wird.
Leider musste ich einsehen, dass ich mich in den Städten noch immer schwertue. Die Filter in meinem Gehirn arbeiten noch nicht so gut, wie ich es vielleicht gern hätte. Seit Corona hat sich das sehr verschlechtert und ich schaffe es noch nicht, das zu überwinden. Meist gutgelaunt komme ich aus der Natur in die Städte, um dann festzustellen, dass ich überhaupt nicht damit klarkomme.
Schon auf den ersten Metern in die Stadt überkommt mich ein sonderbares Gefühl der Überforderung. Ich kann Kilometerlang durch die Natur gehen, aber beim Betreten einer Stadt bekomme ich sofort Unsicherheiten beim Gehen und der Blickwinkel engt sich ein. Es sind mehr Fußgänger, mehr Autoverkehr, mehr Hupen und Lärm. Inmitten von Häuserschluchten bin ich so vielen Reizen ausgesetzt, die mein ganzes System überfordern. Es war schon einmal besser, das war aber vor Corona.
Von März 2020 bis September 2022 bin ich nur einmal mit der Straßenbahn gefahren und ein paar mal mit dem Öffi-Bus. Das Angewöhnen an die Stadt habe ich nach Corona neu zu lernen, all das vorangegangene steht wieder auf null. Die Auswirkungen sind leichter Schwindel, Unsicherheiten, roboterhaftes Gehen, eine Orientierungslosigkeit und eine "ich will nur weg" Einstellung. Es wartet noch viel Arbeit, mich wieder daran zu gewöhnen.
Ja, in der Natur blühe ich auf und ich spüre eine verbesserte Wahrnehmung. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ich mich in zwei Jahren Pandemie praktisch nur zu Hause und in der Natur aufgehalten habe.
Wollte ich mich vor der Pandemie wieder unbedingt an die Stadt gewöhnen, so ist es mir jetzt nicht mehr so wichtig. Die Natur am Camino war so viel schöner und es geht ums Wohlfühlen und nicht darum, mich mit aller Gewalt an etwas zu gewöhnen. Die Stadt erfordert wieder ein langsames Annähern, so wie am Anfang meiner Rehabilitation.

Der einzige "Erfolg" in Santiago war es, dass ich diesmal alleine in die Kathedrale ging und erstmals den Botafumeiro anschauen konnte, das große Weihrauchgefäß, das bei einer Messe geschwenkt wird. Bei meinem Winter-Camino 2020 war die ganze Kirche eine Baustelle, weil sie für das heilige Jahr restauriert wurde und der Botafumeiro abgebaut. Dafür konnte ich damals den heiligen Jakob von hinten umarmen, was diesmal wegen Covid nicht mehr möglich war.
Schlechtes Wetter kann mir kaum was anhaben, doch diesmal war es einen Tick zu viel. 12 Tage Dauerregen machte es unmöglich sich am Weg niederzulassen, etwas anzuschauen oder eine Pause im freien Gelände zu machen. Es waren Sturzbäche, die sich über Galizien ergossen.
Auch der Wind war stark, riss aber ein-, zweimal am Tag für zehn Minuten den Himmel auf und zeigte kurz blau. Das erfreute das Auge, auch wenn man selbst noch im Regen stand. Beim Gehen wurde ich immer wieder ans Krankenhaus erinnert, wo ich monatelang nur beim Fenster hinausschauen konnte und den Regen berühren wollte. Vielleicht auch deswegen meine positive Einstellung zum Regen.
Da war der Wind ein anderes Thema. Meine Tiefensensibilität kann Wind nicht so schnell ausgleichen und daher gehe ich meist wie betrunken. Allerdings verfalle ich nicht mehr so oft wie früher in ein roboterhaftes Gehen, sondern kann die im therapeutischen Tanzen gelernte Beweglichkeit immer besser umsetzen.
Am Ende der Welt, in Finesterre, konnte ich am Cap die zehn Minuten mit ein wenig blauen Himmel ausnützen, um Fotos zu machen. Der Sturm war aber stark und Windlose Stellen gab es kaum.
In Santiago hatte ich noch ein paar Tage, bis mein Bus nach Hause ging. Es gab Parks und Spaziergänge, statt Museen und Sehenswürdigkeiten. Nach dem anstrengenden Camino Finesterre, suchte ich die Ruhe und weniger die Stadt. Ursprünglich hatte ich vor, Museen und nochmals die Kathedrale zu besuchen, allerdings musste ich meine Pläne ändern. Die Hochsensibilität machte mir einen Strich durch die Rechnung.
Deshalb ging ich rund um Santiago und bekam die Kathedrale von allen Seiten zu sehen. Immer wieder kurze Regenschauer waren auch jetzt noch an der Tagesordnung.
Der Weg war wieder ein weiterer Baustein auf dem Weg ins Leben. Gehen ist aber nicht nur Therapie für mich, sondern eigentlich das einzige, was ich wirklich kann und gibt mir Sinn im Leben. Natürlich trainiere ich auch weiterhin alle anderen Bereiche, allerdings sind die Fortschritte überschaubar.
Seit dem Hirnabszess bin ich mit diesem Camino einmal rund um die Welt gegangen, also rund 40.000 km. Die Aussage eines Arztes vor sechs Jahren blieb mir bis heute im Gedächtnis:
"Neurologisch kann man gar nicht zu viel machen, es gibt kein zu viel!"
Vielleicht habe ich es zu wörtlich genommen, aber dieser Satz treibt mich bis heute an und gibt mir bisher auch recht. Es machte das Gehen zum Wichtigsten in meinen Leben. Zum Glück, denn ohne die Millionenfachen-Wiederholungen wäre ich ein Pflegefall geblieben, denn meine Propriozeption oder auch Tiefensensibilität genannt, ist zum größten Teil durch den Hirnabszess verloren gegangen.
Dieses "einmal rund um die Welt", sind ca. 40.000 Kilometer, die ich mit dem Camino im Oktober bisher zurückgelegt habe. Wenn mir das jemand vor sechs Jahren gesagt hätte, ich hätte es ihm nicht geglaubt. Allerdings hat mich diese obige Aussage damals angetrieben, immer noch diese Extrameile zu machen, von der Bruce Lee sprach und ich machte manchmal sogar mehr.

Diese Propriozeption kann ein Hund sein. Gehe ich weniger, übe und trainiere ich weniger, lasse ich ein, zwei Tage aus, bildet sie sich zurück. Denn sie ist nicht nur das Gehen, sondern auch die Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum. Zu wissen, wo der Körper endet, ist wichtig. Fehlt sie, ist es wie im Finstern eine unbekannte Kellerstiege hinunterzusteigen.
Die Millionenfachen-Wiederholungen im Gehen, machten es einfacher, mich daran zu gewöhnen und zu versuchen, wieder mehr Automatik zu bekommen. Trotzdem ist immer ein Restgedanke beim Ablauf des Gehens, deswegen tue ich mich noch oft schwer, im Gelände zu sprechen. Single Tasking lässt grüßen, Multitasking wäre gut.
Der Abszess lag an einer ungünstigen Stelle, nämlich am Thalamus, der Steuerzentrale des Körpers. Deshalb auch meine vielfältigen Handicaps, denn es ist praktisch alles von Körper und Geist betroffen. Am Jakobsweg vergesse ich oft während dem Gehen zu Grüßen, da ich oft zu sehr mit dem Bewegungsablauf beschäftigt bin.

Diese Steuerzentrale, der Thalamus, steuert im Körper die Bewegung, aber auch das Denken und die Wahrnehmung. Also alles, was für das "normale" Funktionieren notwendig ist. Bisher war "einmal rund um die Welt" notwendig, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Allein der Aufwand zum Erhalten ist enorm. Das dran bleiben ist notwendig, um es wenigstens gleich belassen zu können oder vielleicht Verbesserung zu erreichen.
Aus diesem einmal rund um die Welt wird ab sofort ein zweites Mal. Rund 8.000 Kilometer habe ich davon auf Pilger- und Fernwanderwegen zurückgelegt, der Rest passierte in der Heimat.
Besonders in der Corona-Pandemie erkundete ich praktisch jeden Tag den Grazer Norden. Der Camino in Spanien bekam einen besonderen Stellenwert in den letzten sechs Jahren, denn er ist meine größte Reha-Anstalt der Welt geworden. Wie kaum sonst wo kann ich hier Therapie und Leben verbinden.
Jeden einzelnen Meter habe ich unter Freude zurückgelegt, selbst schwierige Bedingungen konnte sie mir nicht nehmen. Egal ob im Sturm am Jakobsweg, im Regen am Walkabout durch Österreich oder im Schnee zu Hause hinter dem Haus, die Freude ist mir dabei immer geblieben. Gelang etwas nicht, war es nur ein Ansporn, es immer und immer wieder zu versuchen.
Diese Freude am Tun ist eine Grundvoraussetzung für meine Genesung und dass ich überhaupt wieder gehen gelernt habe.
Die ersten 10 Tage war ich mit meinem jüngeren Sohn Elvin unterwegs. Wir starteten in Saint Jean Pied del Port, dem Beginn des Camino France. Kühle Temperaturen begleiteten uns dabei. In Logrono verließ er mich, um nach Hause zu fahren, seine Achillessehne schmerzte zu sehr. Ich setzte meinen Weg allein fort.
Ich bin glücklich nun beiden Kindern einen Teil des Camino in Spanien gezeigt zu haben, nämlich das, was mir nach dem Hirnabszess so sehr geholfen hat.

Für diesen Camino hatte ich mir ja einiges vorgenommen. Wenn die Bedingungen passen, wollte ich eine Nacht durchgehen, bzw. unter freiem Himmel verbringen. Zwei Tage vor Vollmond war es dann`` so weit.
Ich startete in Santa Domingo und kam bei Tageslicht bis etwas nach Villafranka. Damit hatte ich die ganze Nacht Zeit, bis nach Burgos zu kommen, wo mir zwei Bergüberquerungen bevor standen. Da bald Vollmond war, begleitete mich der Schein des noch nicht vollen Mondes. Die Stirnlampe brauchte ich jedoch fast nie, so hell schien der Mond. Dafür war die Milchstraße nicht so gut zu sehen, was aber verschmerzbar war, angesichts der herrschenden Stimmung.
Dreimal legte ich mich für eine Stunde aufs Ohr, zum Glück spielten die Temperaturen mit. Der dünne Daunenanorak reichte aus und ich begnügte mich damit, mich auf eine Parkbank zu legen oder um drei Uhr früh, auf zusammengeschobenen Sesseln eines Cafés kurz die Augen zuzumachen. Es war einfach nur herrlich, zum ersten Mal diese Momente zu erleben, wo ich doch normalerweise schon um 6 - 8 Uhr zu Bett ging. Nichtsdestoweniger, hatte ich den Schlaf nachzuholen, was zum Glück leicht ging, erreichte ich doch die nächste Stadt schon am Vormittag und legte mich dann ab Mittag in der Herberge zum Schlafen.
Das besondere war aber, wie ich mit der Tiefensensibilität umging? Denn im Finsteren konnte ich meine Füße kaum sehen und ich musste meist, ohne sie zu sehen, auftreten. Aber nur fast, denn der Mond unterstütze es, die Konturen des Weges zu sehen, damit war es doch einfacher, als in stockdunkler Nacht.
Der Aufstieg zum Cruz de Matagrande en Atapuerca war wegen der vielen Steine nicht leicht, aber bewältigbar. Oben am Kreuz war ich gegen Mitternacht, bei einzigartiger Stimmung. Im fernen sah ich die Lichter von Burgos, dass ich dann in der Früh erreichte.
Nichts denken, nur gehen und Kopf ausschalten. Das war das Motto für die Meseta. Die Tage vergingen wie im Fluge und ehe ich mich versah, war ich in Leon. Hier legte ich einen Ruhetag ein, denn ich wollte danach wieder Kilometer machen. In einem Rutsch ging es nach Astorga und ich war überrascht von der Menge der Menschen am Weg, besonders aus Südkorea.
Um allzu volle Herbergen vermeiden zu können, besorgte ich mir in Leon vorausschauend eine Unterlegmatte, die ich auf 80 x 40 cm verkleinerte. Im Fall des Falles wollte ich die Freiheit haben, eine Nacht auch im Freien zu verbringen.
Ursprünglich nicht geplant, überquerte ich den Bergzug mit dem Crux de Ferro an einem Tag, bis nach Ponferrada. Die möglichen Herbergen beim Abstieg vermied ich, weil sie recht voll waren. Ich war auf Natur gepolt und kam mit zu vielen Menschen auf einem Fleck nicht klar.
In der Herberge in Ponferrada war ein sehr unruhiger Spanier im Zimmer, der mehrmals in der Nacht aufstand, um Rauchen zu gehen. Das weckte in mir erneut das Verlangen, die nächste Nacht wieder im Freien zu verbringen.

























Im Laufe des folgenden Tages verfestigte sich der Gedanke, die Nacht im Freien zu bleiben. Allerdings stand die Überquerung des C'Obreiro bevor. Ich ließ mir ein bisschen zu viel Zeit davor und musste den schwierigen Aufstieg zu einem großen Teil in Finsternis zurücklegen. Ein traumhafter Anblick der Milchstraße entschädigte mich jedoch.
Um 23 Uhr jausnete ich vor der ältesten Kirche am Camino Frances, in C'Obreiro. Immer noch begleitet vom traumhaften Sternenhimmel, mit der Milchstraße in ihrer vollen Pracht. Von der Schönheit beschwingt, ging ich weiter, um allerdings kurze Zeit später in einen nasskalten Nebel einzutauchen. Das hatte ich nicht erwartet. Die warme Nacht wechselte zu kühlen Temperaturen, mit Nässe und dichtem Nebel. Die Stirnlampe leuchtete mir nur schwer den Weg.
Es beschränkte sich nicht nur auf die Gipfelregion, sondern zog sich bis ins Tal. Am Alto del Plano war der Nebel so dicht und die Nacht so schwarz, dass ich nicht einmal den oberen Teil des dortigen Denkmals erkennen konnte. Auch zum Hinlegen fand ich keinen trockenen Platz, so blieb mir nur das Weitergehen. Erst um vier Uhr früh fand ich eine trockene Bank, die so kurz war, dass ich mich mit angezogenen Beinen darauf hinlegen konnte.
Um halb sechs ging es wieder weiter, wo ich dann beim ersten Öffnen eines Cafés gegen 6h30 in Triacastela eintraf. Bald nach mir fanden sich immer mehr Pilger ein, die gerade beim Aufbruch waren und ihren ersten Kaffee einnahmen.
Die folgenden Tage verschlechterte sich das Wetter immer mehr und ich erreichte im Regen Santiago. Die wenigen Regenpausen nutzte ich für Fotos. Diesmal schaffte ich es sogar allein in die Kathedrale und sah zum ersten Mal den Botafumeiro, das Weihrauchfass, das bei den Gottesdiensten geschwungen wird.
2020, bei meinem ersten Besuch der Kathedrale, war er wegen der Renovierung der Kathedrale für das heilige Jahr nicht zu sehen. Dafür durfte ich damals den heiligen Jakob umarmen, was diesmal wegen der Covid-Regeln nicht mehr erlaubt war.













Nach einem Tag in Santiago brach ich nach Finesterre auf. Schwere Regenfälle mit Sturm sollten mich die nächsten drei Tage nach Finesterre begleiten, ans "Ende der Welt"!










Ich konnte wieder viel über mich erfahren, meine Rehabilitation voranbringen und neue Ideen sammeln. Zunächst muss ich alles noch sacken lassen, bis ich die Zeit aufarbeiten kann. Noch steht mir ja der Weg nach Muxia bevor.
Ein Traum wurde wahr, eine Nachtwanderung am Camino Frances. Seit meinem ersten Weg 2018 spuckte es mir im Kopf herum, den Camino auch einmal bei Nacht zu erleben. Früher aufstehen und etwa eineinhalb, zwei Stunden im Dunkeln zu gehen, daß war mir schon vergönnt. Eine Nacht durchzugehen verhinderten bisher die Folgen des Hirnabszesses.
Damals, auf dem Weg nach Finesterre, ging ich dem untergehenden Vollmond nach. Seit damals bin ich fasziniert vom Gehen in der Nacht. Meine Verbesserte Wahrnehmung sollte es mir diesmal ermöglichen.

Damals entstand der Traum einer kompletten Nacht im Freien. Bisher war es nicht möglich, denn das fehlende Gefühl für die Stellung der Gelenke kann ich zwar kurzfristig ausgleichen, aber noch nie eine ganze Nacht hindurch. Allerdings hat sich meine Wahrnehmung in den letzten Wochen verbessert, deshalb wollte ich es endlich einmal probieren. Es wurde einer dieser Tage (Nächte), für das sich die unzähligen Stunden, Wochen und Monate des Trainings auszahlten.
6 Jahre Training sollten sich in dieser Nacht bemerkbar machen. Was habe ich für diesen Zustand nicht alles getan? In diesen Tagen hatte ich oft davon gesprochen oder auch daran gedacht, wie mir eine Ärztin 2017 sagte, ich solle einen Gang zurück schalten und es akzeptieren wie es ist, weil sich nicht mehr viel verbessern wird. Damals konnte ich 300 (dreihundert) Meter am Stück gehen und ein, vielleicht zwei Kilometer, mit vielen Pausen, als gesamte Tagesleistung.
Es war ihr Glaube, zum Glück nicht meiner. Das ich diese Nacht schaffen konnte, ist wohl auch den endlosen Kilometern schuldig, die ich bisher zurücklegte. Mit diesem Camino bin ich seit 2016 einmal um die Welt gegangen, also rund 40.000 Kilometer. Doch dazu mehr in einem anderen Blog.
Am Camino müssen Herbergen spätestens um 8 Uhr verlassen werden. Das zögerte ich bis zuletzt hinaus, denn ich wollte jede mir mögliche Kraft über den Tag sparen. Eigentlich war ich mir noch gar nicht sicher, ob ich es machen wollte oder nicht, aber zumindest im Hinterkopf hatte ich es. Ich verließ Santa Domingo de la Calzeda und nahm mir das 22 Kilometer entfernte Belorado zunächst als Ziel. Dort wollte ich weitersehen.

Es war geradezu heiß, sodass ich mich erstmals entschied, meinen Sonnenhoody zu tragen. Langarm und mit Kapuze, ist es selbst hier noch ein Novum. Bei den Amerikanischen Thru-Hikern ist es gang und gäbe, bei starker Sonne Langarm und mit Kapuze zu laufen.
Wie so oft am Camino, brachte er auch diesmal eine, wenn auch nur für kurze Zeit, eine Bekanntschaft, die ich sogar unbekannterweise kannte. Zunächst unterhielten wir uns noch auf Englisch, schwenkten aber schnell auf Deutsch um, als wir uns als Landsleute erkannten. Sie war die Tochter eines mir bekannten Ehepaares aus meinem früheren Wohnort Peggau, die ich von früher allerdings nur vom Sehen kannte. So weit entfernt, trifft man unverhofft Bekannte.
In Belorado entschied ich mich fürs Weitergehen, die endgültige Entscheidung sollte aber in Villafranka, vor dem Berg, fallen. Dort angekommen, hatte ich ein tolles und interessantes Gespräch mit Alfonso, der die Bar bediente. Ich konnte dadurch sehr gut selbst reflektieren und dringende Fragen bekamen Antworten, bzw. brachten Denkanstöße.
Nach dem Gespräch und einem Kaffee mit Orangensaft, legte ich mich ins Gras, pflegte meine Füße und entschied mich für die Nachtwanderung. Keine Störung von Außen sollten meine Gedanken beeinträchtigen. Das soeben erlebte, wollte verarbeitet werden. Den Berg überwand ich sogar noch bei Tageslicht und erreichte San Juan de Ortega bei Sonnenuntergang. Es war einfach nur toll, in die untergehende Sonne hineinzuwandern. Eigentlich hört man da meistens auf und kümmert sich um eine Herberge und etwas zu Essen.
Es war zwar noch nicht Vollmond, aber er scheinte doch sehr hell. Der Sternenhimmel kam nicht ganz zur Geltung, aber die Stimmung war einmalig. Der fast Dreiviertelmond brachte jedoch gleich so viel Licht, dass ich die Stirnlampe kaum brauchte. Für den Vollmondtag ist ja leider Bewölkung vorhergesagt, weshalb ich mich schon jetzt für diese klare Nacht entschied.
Auf meiner linken Seite wanderte der Mond mit mir mit. Am Cruz de Matagrande en Atapuerca, einer Bergüberquerung vor Burgos, stand ich um Mitternacht am Kreuz. Der Mond leuchtete hell und ich war umringt von einer einzigartigen Lichtstimmung.
An diesem Kreuz habe ich 2018 Freudentränen vergossen, denn der Aufstieg war damals mit der Halbseitenlähmung ein schwieriges Unterfangen, besonders die vielen Steine setzten mir sehr zu. Ich setzte mich wie damals unters Kreuz, diesmal aber bei Nacht und rekapitulierte im Schnelllauf die vergangene Zeit. Um halb eins in der Früh begann ich den Abstieg, begleitet von einem warmen Wind, als ob mir das Universum sagen wollte, gut gemacht!


Eine kurze Schlafpause legte ich im nächsten Dorf in einem Gastgarten ein, wo ich mir zwei Stühle herrichtete. Die Rast tat gut, denn sonst wäre ich zu früh in Burgos angekommen.
Entgegen meiner bisherigen Wege ging ich diesmal nicht den Alternativweg, sondern wollte den Hauptweg hinein nach Burgos kennenlernen. Leider kein guter Gedanke, denn der Weg entlang der Straße war wirklich nicht schön und ich wäre besser bei der Alternative geblieben.
In Burgos legte ich mich nochmal für eine halbe Stunde auf einer Parkbank hin, bevor es in die Innenstadt ging. Es war ein paar Minuten nach sechs Uhr und ich hoffte auf ein offenes Café. Es sollte aber noch bis sieben Uhr dauern, bis eines öffnete. Ich war der erste Gast, aber nach und nach trudelden die ersten Pilger ein, allerdings um vor ihrem Weiterweg zu frühstücken. Ich war sicher der einzige, der gerade angekommen ist und sich jetzt gerne zum Schlafen hingelegt hätte.
Da die Herberge erst um 12 öffnete, spazierte ich in der Innenstadt umher und besuchte mehrere Cafés.
Vorwiegend positiv ist mein Resümee über diese Nachtwanderung. Eigentlich nur positiv, was die Nacht betrifft. Einzig eine verminderte Reaktion, Koordination und Müdigkeit über den Tag blieben zurück. Vor allem das Gehen im Dunklen war zwar anstrengend, aber gut machbar. Ich stiefelte zwar manchmal wie am Anfang in Skischuhen dahin, aber nur in Momenten wo es steinig und schwierig war oder wo ich stürzen konnte.
Eine gute Unterstützung waren mir meine Hoka Schuhe, die auch größere Steine und Unebenheiten schlucken und mir ein leichteres Gehen ermöglichten. Diese Nachtwanderung zeigte mir aber auch auf, wo ich noch Verbesserungsbedarf habe, woran ich noch trainieren kann und wo meine Limit liegen. Ich möchte noch mehr Automatisation bekommen, denn dann wird alles gleich nochmal viel leichter.
Zum Abschluss kann ich nur sagen, gerne wieder! Ich werde es sicher noch einmal probieren, dann aber besser planen, denn Burgos kam viel zu früh und das nichts offen hatte, erschwerte die Sache. Insgesamt hatte ich rund 80 km zurück gelegt, vom Morgen ab Santa Domingo, bis Burgos, um 5 Uhr früh.
