MENÜ

Ich erfreue mich am Gehen. Einerseits notgedrungen, denn etwas anderes ist mir derzeit nicht möglich. Andererseits habe ich die Langsamkeit des Gehens schätzen und lieben gelernt. Natürlich fehlt mir das Laufen durch Flur und Wald, besonders im Hochgebirge. Doch wenn das Laufen nicht geht, dann geht es nicht. So habe ich das Gehen für mich entdeckt – und zurzeit kann ich mir kaum etwas Schöneres vorstellen, als mehrere Wochen am Stück zu wandern. Leider bin ich noch nicht so weit.
Es fällt nicht leicht, zu akzeptieren, was nicht mehr geht. Laufen gehört dazu, ebenso das Radfahren. Seit meiner Kindheit war ich Radfahrer, später sogar leistungsorientiert. Spät, aber mit umso größerer Leidenschaft, kam das Laufen hinzu, das Trailrunning in den Bergen. Diese beiden Sportarten haben mich um die ganze Welt begleitet, brachten Abenteuer, unvergessliche Momente und nicht selten auch meinen Lebensunterhalt. Das alles ist nun vorbei. Es ist ein langer, mühsamer Prozess, das anzunehmen – Abschied zu nehmen von dem, was einst so selbstverständlich war.
Doch im Gehen habe ich etwas Neues gefunden. Schritt für Schritt lerne ich die Langsamkeit zu schätzen, die Ruhe der Bewegung, die Freiheit des einfachen Vorankommens. Es ist ein Wandel, der Geduld erfordert, und manchmal auch die Fähigkeit, sich selbst zu verzeihen. Und vielleicht ist es genau das, was das Gehen mir schenkt – die Einsicht, dass es nicht um das Rennen geht, sondern um das Ankommen bei sich selbst.

Noch immer kämpfe ich darum, meine Fitness langsam wieder aufzubauen. Langsam deshalb, weil mein Nervensystem seit dem Hirnabszess beschädigt ist und ich das Tempo annehmen muss, das meine Nerven vorgeben. Es ist ein zäher Weg, der Geduld verlangt – mehr Geduld, als ich manchmal aufbringen möchte.
Laufen ist nicht möglich. Die Koordination fehlt, die Kontrolle über die Bewegungen ist nicht da. Was früher selbstverständlich war, ist nun unerreichbar fern. Doch das Gehen bleibt mir – Schritt für Schritt. In dieser Langsamkeit liegt eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Ich lerne, die kleinen Fortschritte zu schätzen und mich über jeden Meter zu freuen, den ich mir zurückerobere. Es mag ein langsamer Weg sein, doch es ist meiner – und ich gehe ihn weiter.
Im Krankenhaus war es mein großes Ziel, wieder ins Freie zu gelangen. Nach über vier Monaten war es soweit. Ich konnte zum Ersten mal im Freien spazieren gehen, nachdem ich vier Monate nur im Inneren von Häusern oder Krankenzimmern verbracht hatte.
Wenn ich meinen Werdegang seit damals anschaue, dann ist es bisher ein riesiger Erfolg. Ich könnte auch ans Bett gefesselt sein oder nur unter größten Schwierigkeiten gehen. Das muss ich mir immer vor Augen halten, wenn meine Ungeduld wieder einmal zum Vorschein kommt.
Damals musste ich mich alle 30 bis 50 Meter für eine Pause hinsetzen, aber ich war nur glücklich draußen zu sein. Ich war im Glauben, dass mir nur die Kondition fehlt, um wieder aktiv unterwegs zu werden.
Die Fortschritte waren am Anfang gut. Es ist allerdings wie im Sport, am Anfang geht am meisten weiter. Desto weiter man kommt, desto mehr muss für einen Fortschritt getan werden und das gilt für die Nerven speziell. Das bekomme ich jetzt besonders zu spüren.
Ich begann bei null. Im Krankenhaus war es mein größtes Ziel, wieder ins Freie zu gelangen. Nach über vier langen Monaten war es endlich soweit: Zum ersten Mal durfte ich hinaus, durfte die frische Luft spüren, nachdem ich so lange nur die Wände von Krankenzimmern und Fluren gesehen hatte. Von einem „Schritt“ zu sprechen, wäre jedoch übertrieben – ich wurde mit dem Rollstuhl hinausgeschoben und saß einfach nur da, erstmals unter freiem Himmel.
Und doch war es ein Moment des Glücks – ein kleiner Sieg, der sich anfühlte wie ein großer. Die Luft auf der Haut, der weite Blick, der Himmel über mir – all das war plötzlich wieder greifbar. In diesem Augenblick war das Sitzen im Freien mehr, als ich je für möglich gehalten hätte.
Es war der Anfang. Der Weg zurück ins Leben begann nicht mit einem Schritt, sondern mit dem schlichten Dasein – draußen, frei, und doch so abhängig. Ich wusste nicht, wie weit es mich noch bringen würde. Doch dieser erste Augenblick zeigte mir, dass es weitergehen konnte, Schritt für Schritt, auf eine Weise, die ich damals noch nicht begreifen konnte.
Wenn ich heute auf meinen Weg seit damals zurückblicke, dann ist es ein Erfolg, den ich mir immer wieder bewusst machen muss. Es wäre leicht möglich gewesen, dass ich für immer ans Bett gefesselt geblieben wäre oder nur mit größter Anstrengung wenige Schritte hätte gehen können. Diese Gedanken rufe ich mir in Erinnerung, wenn die Ungeduld in mir aufflammt und ich hadere mit dem Tempo meines Fortschritts.
Anfangs waren es nur 10 bis 20 Meter, bis ich eine Pause brauchte. Aber ich lernte zu Gehen, und das allein erfüllte mich mit Freude. Ich glaubte, es wäre bloß eine Frage der Kondition, bis ich wieder aktiv unterwegs sein könnte. Die ersten Fortschritte kamen schnell. Wie im Sport ist es am Anfang leichter: Die Schritte werden länger, die Pausen kürzer, und die Hoffnung wächst.
Doch je weiter man kommt, desto mehr Mühe kostet der nächste Schritt – und das gilt besonders für die Nerven. Jetzt, wo die großen Sprünge ausbleiben, spüre ich das deutlich. Jeder Fortschritt verlangt Geduld und Beharrlichkeit, oft mehr, als ich meine aufbringen zu können. Aber genau darin liegt die Herausforderung: Dranzubleiben, auch wenn es mühsam wird, und zu erkennen, wie weit der Weg schon gegangen ist. Schritt für Schritt.

Das normale Zeitmaß darf ich nicht anwenden. Meine Rehabilitation dauert um ein Vielfaches länger. Eigentlich stehe ich noch immer beim Gehenlernen – Schritt für Schritt, mit einer Langsamkeit, die sich kaum beschleunigen lässt. Zu viele Kleinigkeiten stehen mir im Weg, Dinge, die für Gesunde kaum nachvollziehbar sind.
In Wahrheit ist jeder einzelne dieser Punkte eine große Herausforderung und muss für sich behandelt werden. Wenn ich nur das Gehen betrachte, fallen mir sofort zehn Dinge ein, auf die ich achten muss oder an denen ich arbeiten kann: der richtige Stand, das Abrollen der Füße, die Balance halten, den Blick nach vorn richten, die Koordination – und so vieles mehr.
Doch es bleibt nicht beim Gehen. Das Greifen üben, meine Merkfähigkeit verbessern, die Kondition steigern – jeder Bereich fordert seine Aufmerksamkeit, und alles auf einmal ist überwältigend. Es fällt mir noch immer schwer, das Ganze zu überblicken.
Manchmal kommt mir der Weg endlos vor, als würden die Schritte nie leichter werden. Doch dann erinnere ich mich daran, dass jeder kleine Fortschritt zählt – selbst wenn er sich kaum bemerkbar macht. Es ist ein Weg, der Geduld verlangt, mehr als ich oft aufbringen möchte. Aber ich gehe ihn weiter, Schritt für Schritt, so gut es eben geht.
Mein Tag ist nach wie vor ausgefüllt mit Üben und Training. Das klingt nach viel, ist es aber nicht ganz. Noch immer ist meine Aufnahmefähigkeit begrenzt, und ich muss genau planen, was ich wann mache. Jeder Fortschritt braucht seine Zeit, alles dauert länger, als ich es mir wünschen würde.
Den Rest der Zeit verbringe ich damit, mich zu erholen. Die Pausen sind keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit – mein Körper und Geist fordern sie ein. Bin ich von der Familie gefordert, muss das Training kürzer treten. Es ist ein ständiges Austarieren zwischen Üben und Ruhen, zwischen Wollen und Können.
Manchmal fühlt es sich an, als ginge es nur langsam voran. Doch auch kleine Schritte sind Fortschritte, und ich lerne, Geduld mit mir selbst zu haben. Stück für Stück wächst das Vertrauen in den eigenen Körper zurück. Und so übe ich weiter, finde meinen eigenen Rhythmus – mal schneller, mal langsamer, aber immer vorwärts.
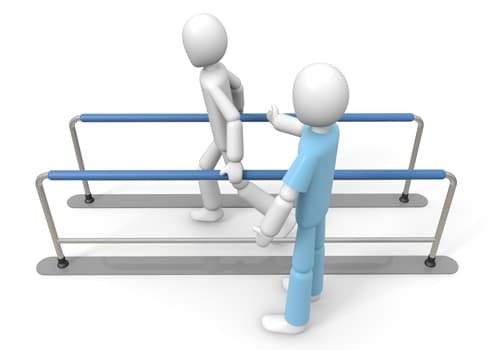
Laufen und meine Koordination – das passt noch nicht zusammen. Es geht mir einfach zu schnell. Mein Gehirn schafft es nicht, die Reize in diesem Tempo zu verarbeiten.
Beim Gehen begann alles mit den einfachsten Grundlagen. Einen Fuß vor den anderen setzen, Schritt für Schritt. Zunächst nur wenige Schritte an der Hand, unsicher und tastend. Später versuchte ich, den 30 Meter entfernten Aufenthaltsraum im Krankenhaus zu erreichen. Es war ein ehrgeiziges Ziel, das mir damals unerreichbar erschien.
Ich bewegte mich dabei oft am äußersten Rand meiner Möglichkeiten und versuchte, diese Grenze Stück für Stück hinauszuschieben. Manchmal gelang es mir, manchmal scheiterte ich. Wenn ich es übertrieb und die Grenze überschritt, endete es oft im Kontrollverlust – im schlimmsten Fall wurde mir schwarz vor Augen, und ich sank ohnmächtig zu Boden.
Doch trotz dieser Rückschläge blieb ich dran. Jede Anstrengung brachte mich ein Stück weiter, und ich lernte, meine Kräfte besser einzuteilen. Das Gehen wurde zur täglichen Herausforderung, aber auch zur Schule der Geduld. Schritt für Schritt, immer an der Grenze entlang, lernte ich, das Unmögliche Stück für Stück möglich zu machen.
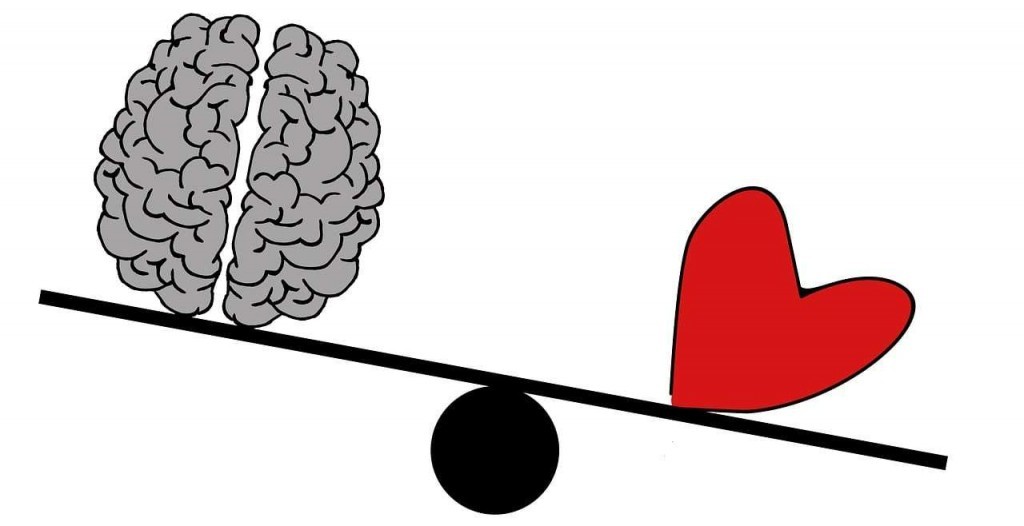
Mehrmals erlitt ich einen Schwindelanfall, weil ich meine Grenzen austestete. Innerhalb von Sekunden wurde mir schwarz vor Augen, und ich stürzte zu Boden. Als ich das Krankenhaus schließlich verließ, konnte ich mich – mit vielen Pausen – etwa 200 Meter weit fortbewegen. (Hier könnt ihr nachlesen, wie ich gehen lernte)
Doch Gehen ist nicht gleich Gehen. Gerade als ehemaliger Leistungssportler und Trailrunner habe ich hohe Ansprüche an mich selbst. Ich gebe mich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Und genau darin liegt die Herausforderung: Ich darf nicht zu viel wollen, muss meine Ungeduld zügeln, auch wenn es schwerfällt. Oft genug hadere ich mit mir selbst, wenn mir alles zu langsam geht.
Dann kommt meistens ein Physiotherapeut, ein Arzt oder jemand anderes, der mich nur alle paar Wochen sieht, und rückt mein Bild von der Realität wieder gerade. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich vor einem Jahr kaum gehen konnte. Der Schwindel war so stark, dass schon das Aufstehen zur Herausforderung wurde. Es dauert einen Moment, aber dann erkenne ich wieder, wie weit ich seitdem gekommen bin.
Laufen macht für mich im Moment noch keinen Sinn – das ist eine bittere Erkenntnis. Aber Gehen ist zum neuen Sinn geworden. Schritt für Schritt, alles zu seiner Zeit. Laufen kommt später, viel später.
Jetzt heißt es dranbleiben. Beharrlich bleiben. Geduldig sein, auch wenn es schwerfällt. Und trotz allem nicht aufgeben, sondern den Weg weitergehen – Schritt für Schritt.

Es ist besonders für Silvia und die Kinder schwer zu verstehen, dass nichts mehr ist wie früher. Wir müssen uns eingestehen, dass meine Rehabilitation noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Bis dahin müssen sie lernen, mit meiner Behinderung umzugehen – und ich ebenso.
Für sie ist es weniger die eingeschränkte Bewegung, die schwierig ist, sondern vielmehr mein noch immer nicht funktionierendes Gedächtnis. Ich merke mir fast nichts und brauche ständige Erinnerungen. Für meine Familie ist das oft mühsam, wahrscheinlich sogar mehr als für mich selbst.
Es gibt kein Zurücklehnen. Jeder Tag beginnt neu, und jeder Tag ist ausgefüllt mit Üben und Training. Gerade der Januar hat mir vor Augen geführt, dass nur tägliches Training zum Ziel führt. Nichtstun bringt mich nicht voran – im Gegenteil, es wirft mich zurück. Nerven haben ihr eigenes Gesetz, und das lässt sich nicht beschleunigen.
Doch die Fortschritte sind mühsam und oft kaum spürbar. Seit der Reha im letzten Jahr plagen mich Kreuzschmerzen, die immer wieder Pausen erzwingen. Und so brachte der Januar eher Rückschritte als Erfolge. Trotz der Arbeit in der Physiotherapie kamen die Verbesserungen nur spärlich.
Manchmal ist es schwer, die Geduld nicht zu verlieren. Doch es bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzumachen – Schritt für Schritt, Tag für Tag. Vielleicht führt der Weg nicht geradeaus, vielleicht gibt es Rückschritte und Umwege, aber es ist mein Weg. Und ich gehe ihn weiter.

Trotz aller Rückschläge lerne ich meinen Körper in solchen Zeiten besser kennen. In den letzten Wochen habe ich mich auch intensiver mit der Funktionsweise des Gehirns beschäftigt. Zumindest weiß ich jetzt, dass mein „noch nicht laufen können“ weniger mit der Kondition zu tun hat, als vielmehr mit meinem Gehirn.
Besonders das Gehen bergauf ist eine eigene Herausforderung. Kaum beginnt der Weg anzusteigen, scheint es mich regelrecht zurückzuhalten. Die Beine werden schwer, die Atmung geht schneller, und es fühlt sich an, als würde die Schwerkraft plötzlich mein Gewicht verdoppeln. Jeder Schritt wird zur Kraftprobe, und es kostet ungeheure Anstrengung, überhaupt voranzukommen.
Deshalb kann ich auch noch nicht ans Pilgern denken. Schon der Gedanke an einen Rucksack von nur 8 Kilogramm wirkt abschreckend – er fühlt sich an, als würde er das Doppelte oder Dreifache wiegen. Unter dieser Last wird jeder einzelne Schritt zur Herausforderung.
Doch so frustrierend das manchmal ist, hilft es mir, besser zu verstehen, was in meinem Körper vor sich geht. Es sind nicht nur Muskeln und Kondition, die mich ausbremsen, sondern ein Zusammenspiel aus Nerven, Wahrnehmung und Koordination. Dieser Kampf ist anders, als ich es vom Sport gewohnt bin. Es geht nicht um Durchhaltevermögen allein, sondern um das Erlernen von Bewegungen, die früher selbstverständlich waren.
Es bleibt ein mühsamer Weg. Aber dieses Wissen gibt mir auch eine gewisse Klarheit. Ich weiß nun, gegen was ich kämpfe – und auch, dass Geduld und Beharrlichkeit meine besten Verbündeten sind. Schritt für Schritt, Steigung für Steigung.
Gleich weitermachen wie bisher! Das ist mein Motto. Jede Verbesserung der Denkleistung hilft mir, einen immer besseren Überblick zu bekommen. Weiterführendes Denken hilft mir, die Koordination besser in den Griff zu bekommen. Eine bessere Belastbarkeit lässt auch mehr Training zu.
Im Vergleich zum Sport früher, trainiere ich noch immer sehr wenig. Allerdings im Vergleich zu vor über einem Jahr, trainiere ich bereits sehr viel. Trotzdem ist in allen Bereichen noch sehr viel Luft nach oben. Gut Ding braucht eben Weile, besonders was die Nerven betrifft.
"Ich sehe nie was bereits getan worden ist, ich sehe stets nur, was noch zu tun bleibt."
Buddah (ca. 400/500 v.Chr.)
